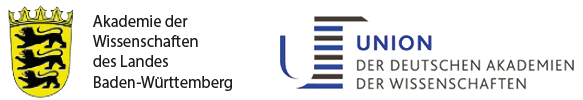Programm
Im Anfang war das Wort - in unserem Fall: die Schrift, und zwar eine „Denkschrift” des Berliner Altphilologen Wolfgang Schadewaldt. Mit seinem programmatischen Memorandum gelang es ihm Ende 1946, die Deutsche Akademie der Wissenschaften davon zu überzeugen, dem bekanntesten deutschen Dichter ein ebensolches Autorenwörterbuch zu widmen, wie sie für die Hauptrepräsentanten anderer Nationaldichtungen längst selbstverständlich waren.
Schadewaldt hatte sich gezielt an eine der Wissenschaftsakademien gewandt, da er in ihnen die „Dombauhütten” der Forschung sah, denen allein man den langen Atem für ein derartiges Projekt zutrauen konnte. Nach Gründung der Arbeitsstellen Berlin und Hamburg (1947) kam es 1951 zur Gründung der Tübinger Arbeitsstelle an Schadewaldts neuem Lehrstuhl. Etwa drei Jahrzehnte später erfolgte die Aufnahme des Unternehmens Goethe-Wörterbuch in das Akademienprogramm für Langzeitvorhaben.
Aufbau der Artikel
Ein größerer Artikel des Goethe-Wörterbuchs baut sich standardgemäß aus acht Teilen auf:
Stichwort, Vorbemerkung, Bedeutungsbeschreibung, Stellenzitate, Stellenangaben, Angaben zu Verwendungsbereichen, Angaben zur Wortbildung, Angaben zur Synonymik.
Die Vorbemerkung kann u.a. enthalten:
- eine Gliederungsübersicht zu dem Artikel,
- Angaben zur Schreibung, Lautung, Wortform, Rektion,
- Angaben zur Frequenz und Verteilung auf die Textgruppen bzw. die Bedeutungen,
- Angaben zur Wortfeldumgebung,
- Angaben zur Wort- oder Begriffsgeschichte,
- Angaben zu Besonderheiten oder Auffälligkeiten des Gebrauchs bei Goethe.
Der Bedeutungsteil ist hierarchisch mit alphanumerischen Gliederungsmarken (I, A, 1, a, α) strukturiert und kann u.a. enthalten:
- Angaben zu den lexikalischen Bedeutungen, gewöhnlich in Form von Definitionen, Synonymen oder Paraphrasen,
- Angaben zu Kontrastwörtern,
- Angaben zu individualtypischen, werk-, figuren- oder kontextspezifischen Bedeutungsmodifikationen, Konnotationen, Wertungen, Perspektivierungen, Referenzen,
- Angaben zu poesiesprachlichen Besonderheiten, z.B. Metaphorik, Symbolik, Ambiguität, Assoziativität,
- Angaben zu begrifflich-terminologischer Verwendung.
Angaben zu Verwendungsbereichen (z.B. anatomisch, architektonisch, bergmännisch), Stilmustern (z.B. Briefstil, Amtsstil) und Stilwerten (z.B. scherzhaft, derb) erscheinen gewöhnlich in Verbindung mit den Bedeutungsangaben.
Die Stellenzitate haben die Funktion, die jeweilige Bedeutung zu belegen und zugleich eine Vorstellung von der Vielfalt der Gebrauchsmöglichkeiten in unterschiedlichen Kontexten zu vermitteln. Sprechende Zitate können die Bedeutungserklärung auch ersetzen. Zitate und Stellenangaben können oft nur in strenger Auswahl gegeben werden.
Arbeitsstelle Tübingen