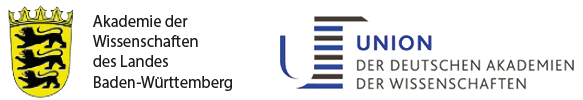Das Wörterbuch der älteren deutschen Rechtssprache

Das Deutsche Rechtswörterbuch (DRW) ist kein enzyklopädisches Lexikon, sondern ein Wörter-Buch. Das heißt, es wird hier das einzelne Wort mit seinen Bedeutungen dargestellt, nicht ein Rechtsinstitut oder Rechtsbegriff mit seiner Geschichte und seinen verschiedenen Bezeichnungen, abgehandelt unter einem Oberbegriff.
Das Deutsche Rechtswörterbuch ist – als ein Wörterbuch der älteren Sprache – ein historisches Wörterbuch. Es behandelt die Sprache des Rechts vom Beginn der schriftlichen Überlieferung in lateinischen Urkunden der Völkerwanderungszeit bis etwa 1800. Für die heutige Rechtssprache müssen Sie in einem modernen Rechtswörterbuch nachschlagen. Es gibt solche beispielsweise von Creifelds und Köbler.
Weiter ist es ein Wörterbuch der deutschen Rechtssprache. "Deutsch" bezeichnet nach der Theorie des 19. Jahrhunderts, in dem das DRW konzipiert wurde, als Oberbegriff die gesamte westgermanische Sprachfamilie, wie Jacob Grimm es in seiner Einleitung zum Deutschen Wörterbuch festgelegt hat, "so dasz gleichwohl die friesische, niederländische, altsächsische und angelsächsische noch der deutschen sprache in engerm sinn zufallen" [Band I, Leipzig 1854, p. XIV].
Und schließlich ist das Deutsche Rechtswörterbuch ein Wörterbuch der Rechtssprache. Der Begriff Rechtssprache bezeichnet keine Fachsprache im engeren Sinne, sondern den Allgemeinwortschatz in seinen rechtlichen Bezügen. Dargestellt wird, wie sich Rechtsvorstellungen und Rechtsinstitute in der Alltagssprache manifestiert haben. Das DRW enthält somit nicht bloß juristische Fachbegriffe, sondern auch alle Wörter der Allgemeinsprache, sofern sie in rechtlichen Kontexten auftreten. So wird auch ein Adjektiv wie "nackt" behandelt – in seiner rechtsrelevanten Bedeutung "im Zustand der Nacktheit als Indiz für Ehebruch". Sie finden bei uns also Wörter wie "machen", "Kuß", "Kessel" und "Linde" ebenso wie "Litiskontestation", "Pfandkonstitution" und "Pfarracker".