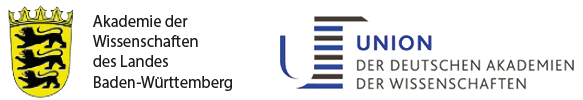Das Deutsche Rechtswörterbuch (DRW) erschließt als Großwörterbuch zur historischen Rechtssprache den rechtlich relevanten Wortschatz des Deutschen (samt weiterer westgermanischer Sprachen) vom Beginn der schriftlichen Aufzeichnung in der Spätantike bis ins frühe 19. Jahrhundert.

Behandelt werden neben Fachtermini des Rechts wie „Akzise“, „Pfefferlehen“ oder „Servitut“ auch Wörter der Allgemeinsprache, sobald ihnen in einem rechtlichen Kontext besondere Bedeutung zukommt; so gibt es im DRW beispielsweise Artikel zu „Kuß“, „lachen“ und „sinnlich“. Erläutert werden – heute oft vergessene – Berufe, Abgabenbezeichnungen, Münzen und Gewichte. Artikel wie „Acker“, „feiern“, „Nachbarschaft“ und „Saubär“ spiegeln den Alltag des Rechtslebens. Das DRW ist somit nicht nur ein zentrales Nachschlagewerk für Rechtshistoriker, sondern zugleich ein hilfreiches Instrument für alle, die mit historischen deutschen (oder westgermanischen) Texten arbeiten. Nicht zuletzt in der allgemein und frei zugänglichen Onlineversion wird das Wörterbuch daher auch weit über die deutschen Grenzen hinaus genutzt.
Fertiggestellt sind bislang rund 100.000 Wortartikel aus den Buchstabenbereichen „A“ bis „S“. Die Artikel werden von einem interdisziplinären Wissenschaftlerteam in der DRW-Forschungsstelle erarbeitet, aufbauend auf einem Archiv mit etwa 2,5 Millionen Belegen und einer wachsenden Textdatenbank. Das zugrunde liegende Corpus enthält etwa 8400 Titel – Quellen und Quellensammlungen unterschiedlichster Textgattungen aus den verschiedensten Regionen (vor allem Mittel-)Europas. Erfasst werden nicht nur Wörter aus allen Sprachstufen des Deutschen – Hochdeutsch wie Niederdeutsch –, sondern auch aus anderen westgermanischen Sprachen, etwa Altenglisch, Langobardisch, Altfriesisch und Mittelniederländisch.
1897 von der Preußischen Akademie der Wissenschaften begründet, wird das Wörterbuchprojekt seit 1959 von der Heidelberger Akademie betreut. Als eines der ersten Wörterbücher Deutschlands ging das DRW 1997/99 online. Die Retrodigitalisierung der alten Bände wurde durch eine Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft ermöglicht.