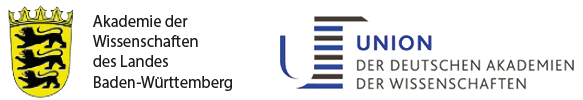Die Inschriften des Mittelalters und der Frühen Neuzeit
Das Ziel des interakademischen Gesamtvorhabens, an dem außer der Heidelberger Forschungsstelle auch die Forschungsstellen in Bonn, Göttingen, Greifswald, Halle, Leipzig, Jena, Mainz, München und Wien beteiligt sind, ist die möglichst vollständige Sammlung und kommentierte Edition aller lateinischen und deutschsprachigen Inschriften des Mittelalters und der Frühen Neuzeit bis zum Jahr 1650. Das Sammelgebiet umfasst nach heutigem Stand Deutschland und Österreich sowie Südtirol. Die Ergebnisse der Sammlung werden in den DI-Bänden ediert. Ein Band beinhaltet entweder die Inschriften eines bzw. mehrerer Stadt- oder Landkreise (in Österreich: Politischer Bezirke) oder die Inschriften einzelner Städte. Bei Städten mit besonders großem Inschriftenbestand werden Einzelkomplexe gesondert ediert. Aufgenommen werden sowohl die noch erhaltenen als auch die nur mehr kopial überlieferten Inschriften.
Die Forschungsstelle Heidelberg
- Kurzporträt (YT) -
Die Heidelberger Forschungsstelle besteht seit 1935. Eine kontinuierliche Forschungsarbeit wurde freilich erst ab 1963 mit der Festanstellung einer hauptamtlichen Mitarbeiterin möglich. Die Forschungsstelle war anfangs zuständig für die Erfassung der Inschriften in Baden, in der Rheinpfalz, im Saarland, in Südhessen, Nassau und in der preußischen Rheinprovinz, zwischenzeitlich darüber hinaus auch im Elsaß und in Lothringen. Nach einer Neuaufteilung der Bearbeitungssprengel zwischen den beteiligten Akademien 1971 ist Heidelberg nunmehr für die Inschriften des Bundeslandes Baden-Württemberg zuständig. Derzeit wird die Editionsarbeit von drei wissenschaftlichen Angestellten geleistet, hinzu kommt eine Stelle für die professionelle Erstellung der Fotos und die Bildbearbeitung.
Gegenstand der Arbeit
Unter Inschriften werden alle Schriftquellen zusammengefasst, die nicht mit den herkömmlichen Methoden der Schreibschulen und Kanzleien hergestellt, also nicht auf Papier oder Pergament geschrieben sind. Auch Druckerzeugnisse gehören nicht zu den Inschriften. Positiv ausgedrückt: Inschriften sind auf Stein, Metall, Holz, Glas, Emaille, Wandputz, Textilien oder tierischen Produkten angebracht und in den unterschiedlichsten Techniken hergestellt: eingehauen, geschnitzt, aufgemalt, gegossen, graviert, gepunzt, getrieben, in Stuck geformt, gestickt, gewebt, geritzt, ausgeschnitten oder in Mosaik ausgeführt. Die Texte der Inschriften besitzen nicht selten hohe historische Aussagekraft, da sie häufig für den öffentlichen Raum bestimmt und dort für eine dauernde Wirksamkeit konzipiert waren. Als Unikate besitzen sie in der Regel eine feste Bindung an den Ort, für den sie geschaffen wurden.
Inschriften auf Grabdenkmälern sichern den Verstorbenen das Totengedächtnis und mahnen die Lebenden an die eigene Vergänglichkeit; Bauinschriften an öffentlichen und privaten Gebäuden nennen Auftraggeber und Jahr der Baumaßnahme; Stiftungsinschriften auf Gegenständen der Kirchenausstattung erinnern an die großzügigen Wohltäter; erklärende oder mahnende Beischriften komplettieren bildliche Darstellungen auf Wand-, Glas- und Tafelgemälden; Urkundeninschriften sichern durch ihre Anbringung an allgemein zugänglicher Stelle Rechtsansprüche; mit Meisterinschriften signieren Steinmetze, Bildschnitzer, Goldschmiede, Maler und Gießer ihre Werke; Gebete und Anrufungen werden durch ihre inschriftliche Ausführung – etwa auf einem Messkelch – 'verewigt'.
Arbeitsmethoden
Grundlage der praktischen Arbeit bildet eine nach Kreisen gegliederte Zettelkartei für ganz Baden-Württemberg. In diese werden alle durch Auswertung der orts-, regional- und kunstgeschichtlichen Literatur erfassbaren Inschriften – sowohl die original erhaltenen als auch die mittlerweile untergegangenen – aufgenommen. Hieraus ergibt sich ein erster Überblick über Anzahl und Standorte der Inschriften als Voraussetzung für die Feldarbeit. Sämtliche erhobene Metadaten werden zudem über eigens hierfür konzipierten Foto-, Objekt- und Standortdatenbanken verwaltet und miteinander verknüpft.
Alle Ortschaften eines Kreises werden bereist und systematisch nach Inschriften abgesucht. Die Erkundungsgänge umfassen die historischen Ortskerne mit ihren Kirchen und Friedhöfen als Schwerpunkten. Museumsbestände werden gesichtet und in den Kirchen die Glocken und liturgischen Geräte auf etwaige Inschriften hin überprüft. Durch Neufunde lässt sich der Inschriftenbestand eines Kreises gegenüber der Ausgangslage gelegentlich um bis zu ein Drittel erweitern. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfassen sämtliche vorgefundenen Inschriften in Aufnahmebögen, dokumentieren sie ausführlich und fotografieren die Inschriftenträger.
Neben der Aufnahme der erhaltenen Inschriften bildet das Ermitteln kopialer Überlieferung von verlorenen Inschriften in öffentlichen und privaten Archiven und Bibliotheken eine weitere wichtige Aufgabe. Wo frühe systematische handschriftliche Inschriftendokumentationen vorliegen, kann der Anteil der Kopialüberlieferung über die Hälfte des gesamten Inschriftenbestandes eines Bearbeitungsgebiets bilden.
Deutsche Inschriften Online
Das Projekt „Deutsche Inschriften Online“ (DIO) wird als interakademisches Projekt betrieben. Die technische Umsetzung obliegt einer eigenen Arbeitsstelle an der Digitalen Akademie in Mainz. Langfristiges Ziel ist die Digitalisierung und Online-Bereitstellung sämtlicher DI-Inschriftenbände.
Die Heidelberger Forschungsstelle beteiligt sich seit 2012 am DIO-Projekt. Bislang wurden elf Bände der Heidelberger Reihe über dieses Portal online gestellt. Die Online-Version bietet die Möglichkeit, erheblich mehr Inschriftenfotos als in den gedruckten Bänden zu veröffentlichen.
Die sieben frühesten Bände der Heidelberger Reihe, die nach modifizierten Editionsrichtlinien erstellt wurden und sich daher für eine Publikation im Rahmen von DIO nicht eignen, wurden als pdf-Dateien über das Digitalisierungszentrum der Universitätsbibliothek Heidelberg online verfügbar gemacht.
Bisher geleistete Arbeit
Zum Zeitpunkt der Gründung des Gesamtvorhabens existierte eine großräumig angelegte, auf Vollständigkeit zielende, systematische und nach wissenschaftlichen Editionsrichtlinien angelegte Sammlung der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Inschriften weder in Deutschland noch im Ausland. Was an Inschriften publiziert worden war, war häufig in weit verstreuten, schwer zugänglichen regional- und ortsgeschichtlichen Schriften erschienen und genügte nur selten wissenschaftlichen Ansprüchen. Und auch eine Epigraphik des Mittelalters und der Neuzeit als wissenschaftliche Disziplin, die sich mit der Erfassung, Edition und Auswertung von nachantiken Inschriften beschäftigt, galt es erst zu erarbeiten und zu etablieren. Hierbei kam der Heidelberger Arbeitsstelle, die zunächst aus Mitteln der DFG und des badischen Kultusministeriums finanziert wurde, die zusätzliche Aufgabe zu, neue Mitarbeiter der übrigen Akademien in die praktische Inschriftenarbeit einzuführen. Die Richtlinien sollten sich im Laufe des Projekts entsprechend den gewonnenen Erfahrungen verändern und verfeinern.
Für die zu publizierenden Inschriftenbände einigte man sich auf den Titel „Die Deutschen Inschriften“ (DI). Sie erscheinen in jeweils eigenen Reihen der beteiligten Akademien. Seit 1990 finden regelmäßige Treffen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Inschriftenarbeitsstellen statt, um eine weitgehende Einheitlichkeit der Bearbeitungs- und Editionsrichtlinien zu gewährleisten. Als ein auch über den Rahmen der epigraphischen Forschung hinaus wichtiges Hilfsmittel ist die gemeinsam erstellte „Terminologie zur Schriftbeschreibung“ (1999) hervorzuheben. Alle zwei bis drei Jahre werden zudem internationale Epigraphik-Tagungen organisiert.
Die von der Heidelberger Forschungsstelle bislang erarbeiteten Inschriftenbände umfassen außerhalb Baden-Württembergs die Städte Mainz (Rheinland-Pfalz) und Fritzlar (Hessen) und den Altkreis Miltenberg (Bayern) sowie innerhalb des Bundeslandes die Landkreise Böblingen, Calw, Enzkreis, Freudenstadt, Göppingen, Hohenlohekreis, Karlsruhe, Ludwigsburg, Main-Tauber-Kreis, Neckar-Odenwald-Kreis, Rastatt, Rems-Murr-Kreis, Rhein-Neckar-Kreis und Schwäbisch Hall sowie die Stadtkreise Baden-Baden, Heidelberg, Karlsruhe, Mannheim und Pforzheim. 2016 konnte die Editionsarbeit im Regierungsbezirk Karlsruhe zum Abschluss gebracht werden. Für den Regierungsbezirk Stuttgart liegt mehr als die Hälfte des Inschriftenmaterials ediert vor. Bis zum (2014 festgesetzten) Laufzeitende 2030 sollen noch die Bestände der Landkreise Esslingen und Heilbronn sowie des Stadtkreises Heilbronn bearbeitet werden.
Bis 2030 ist auch eine sukzessive Onlinestellung der dort noch fehlenden DI-Bände der Heidelberger Reihe im Rahmen von DIO (s. oben) vorgesehen. Eine ursprünglich als Vorarbeit für künftige DI-Bände seit 1989 durchgeführte Fotoinventarisierung der Inschriften im gesamten Bundesland konnte 2018 zu Ende gebracht werden, so dass auch für die für eine Edition nun nicht mehr vorgesehene Südhälfte des Landes immerhin das Bildmaterial weitgehend vollständig zur Verfügung steht.
(Stand: November 2024)