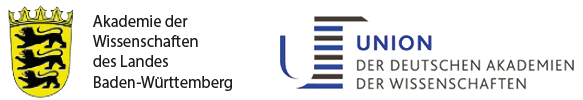Laufzeit: 1986 bis 2021

Seit 2022 ist die EDH über die Universität Heidelberg zugänglich. Dort ist sie über den Fachinformationsdienst Altertumswissenschaften Propylaeum (externer Link) abrufbar.
Die Aufgabe der Epigraphischen Datenbank Heidelberg (EDH) besteht in der systematischen Aufnahme der antiken lateinischen und bilinguen (dabei zumeist lateinisch-griechischen) Inschriften in einer komplexen Datenbank. Aufgrund ihrer interdisziplinär angelegen Konzeption und Arbeitsweise zählt sie zu den international führenden Datenbankvorhaben zur raschen Sammlung und zuverlässigen historischen Auswertung epigraphischer Zeugnisse. Die besonderen Merkmale der EDH liegen auf der regionalen Systematik, der beliebigen Kombinierbarkeit der gespeicherten Metainformationen und der wechselseitigen Verknüpfung der Epigraphischen Text-Datenbank (externer Link) mit den drei weiteren Teildatenbanken der EDH, der Epigraphischen Bibliographie (externer Link), der Epigraphischen Fotothek (externer Link) und der Epigraphischen Geographiedatenbank (externer Link).
Ihr Ziel liegt darin, die epigraphische Dokumentation der Provinzen des römischen Reiches bis zum Jahr 2020 (Laufzeitende des Projektes) so vollständig und zuverlässig wie möglich für Online-Recherchen zur Verfügung zu stellen. Auf Beschluss der Commissione epigrafia e informatica der AIEGL (externer Link) aus dem Jahr 2003 zur Errichtung der internationalen epigraphischen Datenbankföderation EAGLE (Electronic Archives of Greek and Latin Epigraphy) obliegt der EDH seitdem die Betreuung der Inschriften der römischen Provinzen, während die bis dahin über die EDH bereits erfassten Inschriften Italiens der Epigraphic Database Rome (EDR) (externer Link) zur weiteren Bearbeitung und Vervollständigung des Datenbestandes überlassen worden sind. Zweck der EAGLE-Föderation ist es, möglichst alle lateinischen und griechischen Inschriften der Antike nach einheitlichen Kriterien im Internet zugänglich zu machen. Die Gründung der EDR erfolgte zu diesem Zweck in enger Kooperation mit der EDH und nach deren Modell.
Mit der Fertigstellung der angestrebten Datenbank konnte das Projekt Ende 2021 erfolgreich abgeschlossen werden.