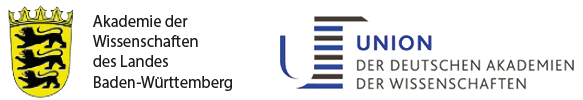In der Mitte des 6. Jahrhunderts n.Chr. begannen chinesische Buddhisten damit, ihre heiligen Texte in Stein zu meißeln. Teils arbeiteten sie unter freiem Himmel auf dem gewachsenen Fels, teils integrierten sie ausgewählte Schriftstellen in das Bildprogramm von Kulthöhlen. Diese steinernen Sutren dienten der Bekanntmachung und Verbreitung der buddhistischen Lehre im Volk. Nach der Buddhistenverfolgung der Jahre 574–577 gewann zunehmend der Gedanke der Bewahrung an Bedeutung. Einflussreiche Förderer des Buddhismus stifteten Geld, um immer umfangreichere Textpassagen in Stein meißeln zu lassen und sie so für die Ewigkeit zu erhalten. Schließlich machten sich Mönche im Wolkenheimkloster nahe Peking daran, den gesamten buddhistischen Kanon auf Platten einzumeißeln, damit er den von ihnen erwarteten Weltuntergang überdauern möge. Aufgabe des Forschungsprojekts ist die Dokumentation, Interpretation und Präsentation dieser Steinschriften.
Inschriften auf dem gewachsenen Fels
In der ersten Phase des 2005 begonnen Projekts stand die Erfassung der Steinschriften unter freiem Himmel in der Provinz Shandong im Vordergrund. Dort wählten gelehrte Mönche kurze, signifikante Passagen aus den buddhistischen Sutren aus und schrieben sie in kunstvoller Kalligraphie direkt auf steile Felsflächen nahe ihrer Klöster. Versierte Steinmetze meißelten in einem zweiten Schritt die bis zu drei Meter hohen Schriftzeichen in den Fels. Diese Zeichen haben sich bis heute erhalten. Die heiligen Texte verkörperten Meditationsobjekte, auf die sich die Mönche während ihrer spirituellen Übungen konzentrierten. Die bewusste Verbindung zwischen Schrift und Stein verleiht den Bergen den Charakter einer heiligen Landschaft.

Entlang eines Pilgerweges wurde auf mächtige, verstreut liegende Felsbrocken ein fortlaufender Text eingemeißelt. Es soll damit die Gegenwärtigkeit der Buddhas, Bodhisattvas und Weisen in einer paradiesischen Landschaft beschworen werden. Dieser Ort galt den Gläubigen als das wahre Buddhaland. Granitflächen auf Bergabhängen wurden zu gigantischen Stelen umgestaltet. In mehreren hundert großformatigen Zeichen konnte auf ihnen ein vollständiges Kapitel eines Sutra eingeschrieben werden.
Inschriften in Kulthöhlen
Noch längere Sutrenpassagen sind in kleinformatigen Schriftzeichen auf den Innenwänden von Kulthöhlen zu finden. Diese Schriftwerke sind zwischen die Skulpturen und Bildgruppen der Heilsgestalten eingefügt und werden somit Teil der religiösen Aussage über den Dharma (die buddhistische Lehre). Eine derartige Verschränkung von bildlicher und nichtbildlicher Vergegenwärtigung religiöser Lehrinhalte ist in der Weltkunst selten und von besonderem erkenntnistheoretischem Interesse.
Der steinerne Kanon im Wolkenheimkloster
Das größte Meißelprojekt der Weltgeschichte begann zu Anfang des 7. Jahrhunderts im Wolkenheimkloster. Zunächst wurden auch hier Texte auf Steinplatten in die Wände einer Höhle eingelassen, der sogenannten ‚Donnerklanghöhle’, welche im Jahr 616 durch ein Reliquiendepositum geweiht wurde. Bald danach meißelten die Mönche die heiligen Schriften nur noch auf vorgefertigte Steinplatten. Diese bargen sie in Höhlen, welche sie mit steinernen Türen auf immer verschlossen. Inschriften außerhalb der Höhlen berichten von der Furcht der Mönche vor dem bevorstehenden Weltuntergang. Im künftigen Weltzeitalter, so hofften sie, würden ihre Steine wie aus einer Zeitkapsel wieder ans Licht kommen und künftigen Generationen von der Lehre des Buddha künden.
Methoden
Dokumentation

Die primäre Aufgabe der Forschungsstelle ist die systematische und vollständige Dokumentation der Steinschriften. Die exakte georeferenzierte Vermessung erlaubt es, die Inschriften als Objekte im Raum zu verstehen und die Relationen zwischen den Inschriftengruppen zu erkennen. Auf diese Weise wird erstmals das Netz von Monumenten deutlich, mit dem die chinesischen Buddhisten die Landschaft in jener Epoche überzogen und prägten. Die fotographische Dokumentation umfasst die bemeißelten Steine sowie Abreibungen der Inschriften mit Tusche und Papier. Bisweilen zeigen ältere Abreibungen einen besseren Erhaltungszustand, weil die Verwitterung der Steine inzwischen vorangeschritten ist. Auch werden, wenn vorhanden, bis zu 200 Jahre alte Umschriften der traditionellen epigraphischen chinesischen Literatur ausgewertet. Das Idealziel ist die lückenlose Rekonstruktion des ursprünglichen Textes. Übersetzungen mit ausführlichem wissenschaftlichem Apparat gehören ebenfalls zur Dokumentation.
Interpretation
Viele Inschriften, insbesondere die jüngst entdeckten, lassen die Geschichte des Buddhismus in neuem Licht erscheinen. Es ist von bedeutenden chinesischen und indischen Mönchen die Rede, welche in den bisher bekannten historischen Quellen nicht auftauchen. Wissenschaftlich relevante Fragestellungen, zu deren Erhellung das Projekt beitragen wird, sind die Praxis der Beicht- und Meditationsrituale, die Kategorisierung apokrypher und kanonischer Texte sowie generell die politische Instrumentalisierung und Sinisierung des Buddhismus in der fraglichen Periode.
Präsentation
In Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern der Fakultät Geoinformationswesen der Hochschule für Technik in Karlsruhe (FH) werden virtuelle Geländemodelle und 3D-Visualisierungen erstellt. Die Bearbeitung und Auswertung der gesammelten Text- und Bilddaten geht einher mit dem Aufbau einer Datenbank, die auf die besonderen Anforderungen der chinesischen Texte und Schriftzeichen zugeschnitten ist. Dabei werden die Standards etablierter buddhologischer und sinologischer Datenbanken und modernste Digitalisierungstechniken genutzt, die der Komplexität der Schriftsysteme in Ostasien Rechnung tragen. Die Forschungsergebnisse sollen auch für das wissenschaftlich interessierte Laienpublikum in geeigneter Form aufgearbeitet und präsentiert werden.
Internationale Zusammenarbeit
Seit einigen Jahren wenden sich chinesische Wissenschaftler wieder verstärkt religionshistorischen Phänomenen zu, da deren Bedeutung für das Selbstverständnis Chinas als Kulturnation neu entdeckt wird. Diese Entwicklung begünstigt die Arbeit des Forschungsprojekts in hohem Maße. Darüber hinaus bestehen enge Verbindungen zu Wissenschaftlern in Japan, die die erstklassige buddhologische Tradition ihres Landes fortführen. Die Sammlung und Auswertung der Daten findet in enger internationaler Zusammenarbeit statt. Projektbegleitend kommen renommierte ostasiatische Forscher und Nachwuchswissenschaftler nach Heidelberg, um mit zu forschen. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zum wissenschaftlichen Austausch zwischen Deutschland und China.