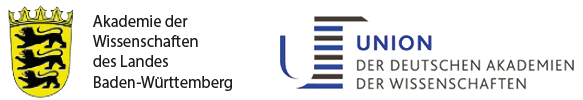Organisationseinheit
Deutsche Inschriften
Adresse
Karlstraße 4
69117 Heidelberg
69117 Heidelberg
Tel
06221 / 54 3269
E-Mail
Curriculum Vitae
- geb. 1969 in Dresden
- 1991-98 Studium der Germanistik und Lateinischen Philologie an den Universitäten Halle-Wittenberg, Rom (La Sapienza) und Freiburg i. Br.
(Erstes Staatsexamen) - 1998-2003 Promotion an der Universität Halle-Wittenberg (Thema: Die Inschriften des ehemaligen Landkreises Querfurt)
- seit 2001 wiss. Mitarbeiter an der Heidelberger Akademie der Wissenschaften (Forschungsstelle: Deutsche Inschriften)
Ausgewählte Publikationen und Vorträge
Monographien:
- Die Inschriften des ehemaligen Landkreises Querfurt, ges. u. bearb. v. Ilas Bartusch (Die Deutschen Inschriften 64), Wiesbaden 2006. (DI 64)
- Die Inschriften der Stadt Baden-Baden und des Landkreises Rastatt, ges. u. bearb. v. Ilas Bartusch (Die Deutschen Inschriften 78), Wiesbaden 2009. (DI 78)
- Die Inschriften des Landkreises Freudenstadt, unter Benutzung der von Anneliese Seeliger-Zeiss erstellten Vorarbeiten zum Kloster Alpirsbach ges. u. bearb. v. Jan Ilas Bartusch (Die Deutschen Inschriften 94), Wiesbaden 2016. (DI 94)
Aufsätze:
- Die Inschriften um Conrad von Einbeck in der Moritzkirche zu Halle, in: Sachsen und Anhalt 21 (1998) 81–127.
- Querfurter Inschriften: Die Grabplatte des Schultheißen Hans Schramm, in: Merseburger Kreiskalender (2002) 32–34.
- Konventionen des antiken Herrscherlobes in frühneuzeitlichen Inschriften, in: Traditionen, Zäsuren, Umbrüche. Inschriften des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit im historischen Kontext. Beiträge zur 11. Internationalen Fachtagung für Epigraphik vom 9. bis 12. Mai 2007 in Greifswald, hg. v. Christine Magin, Ulrich Schindel, Christine Wulf, Wiesbaden 2008, 321–347.
- Die Grabmäler für Markgraf Eduard Fortunat von Baden-Baden in der Stiftskirche zu Baden-Baden, in: Früchte vom Baum des Wissens. 100 Jahre Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Eine Festschrift der wissenschaftlichen Mitarbeiter, hg. v. Ditte Bandini u. Ulrich Kronauer, Heidelberg 2009, 153–170.
- Die Wiederherstellung der markgräflich badischen Grablege in der Stiftskirche der Stadt Baden nach ihrer Zerstörung von 1689, in: Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 157 NF 118 (2009) 249–300.
- Jubelschall und Totenklage – Die Funktionen mittelalterlicher Glocken im Spiegel ihrer Inschriften, in: Jahrbuch der Heidelberger Akademie der Wissenschaften (2012) 121–123 (https://doi.org/10.11588/diglit.55656.33).
- Was Glocken, Grabmäler und Gebäude überliefern. Erfassung historischer Inschriften im Landkreis Freudenstadt, in: Freudenstädter Heimatblätter 46 (2013) Nr. 2, o. S.
- Inschriften im Fokus der Heimatforschung, in: Jahrbuch Landkreis Freudenstadt (2014) 40–47.
- Der Freudenstädter Taufstein und das Bietenhausener Tympanon – Zwei frühe Steinmetzarbeiten der Alpirsbacher Klosterbauhütte, in: Zeitschrift für Hohenzollerische Geschichte 51/52 (2015/16) 1–24.
- Altbekanntes in neuem Licht. Anregungen zu einem zweiten Blick auf historische Inschriften im Landkreis Freudenstadt, in: Freudenstädter Heimatblätter 48 (2017) H. 6, o. S.
- Die Grabplatte des Alpirsbacher Abts Alexius Karrenfurer [Kat.-Nr. IX.12]; Das Epitaph des Alpirsbacher Abts Alexius Karrenfurer [Kat.-Nr. IX.13]; Epitaph des Alpirsbacher Abts Balthasar Elenheinz [Kat.-Nr. IX.14], in: Freiheit – Wahrheit – Evangelium. Reformation in Württemberg. Katalogband zur Ausstellung des Landesarchivs Baden-Württemberg, Hauptstaatsarchiv Stuttgart, 13. September 2017 bis 19. Januar 2018, bearb. v. Peter Rückert unter Mitarbeit v. Alma-Mara Brandenburg u. Eva-Linda Müller, hg. v. Landesarchiv Baden-Württemberg, Hauptstaatsarchiv Stuttgart, in Kooperation mit den Staatlichen Schlössern und Gärten Baden-Württemberg, Ostfildern 2017, 358–360.
- Wer war Abt Alexius? Name und Herkunft eines Alpirsbacher Klostervorstehers, in: Jahrbuch Landkreis Freudenstadt (2018) 132–142.
- Epitaph für den Pfarrer Johann Melsheimer, übertragen und kommentiert von Jan Ilas Bartusch, in: Blätter für pfälzische Kirchengeschichte und religiöse Volkskunde 85 (2018) 127f.
- Waßner, Manfred / Bartusch, Jan Ilas, Exkurs zu den Grabmalen von 1635 an der Marienkirche, in: Bissingen an der Teck. 1250 Jahre Geschichte, im Auftrag der Gemeinde Bissingen an der Teck hg. v. Manfred Waßner, Bissingen an der Teck 2019, 114–117.
- Die inschriftlich bezeichneten Funde aus der archäologischen Grabung auf dem Pforzheimer Rathaushof (2012–2019), in: Neue Beiträge zur Pforzheimer Stadtgeschichte 6 (2020) 85–177.
- Die Grablege der Markgrafen von Baden im Kloster Lichtenthal (Baden-Baden) nach der Wiederherstellung von 1829/32 – Form und Funktion der Gotischen Majuskel aus der Steinmetzwerkstatt Johann Baptist Belzers zu Weisenbach (Lkr. Rastatt), in: Inschriften zwischen Realität und Fiktion. Vom Umgang mit vergangenen Formen und Ideen. Beiträge zur 12. Internationalen Fachtagung für Epigraphik vom 5. bis 8. Mai 2010 in Mainz, hg. v. Rüdiger Fuchs u. Michael Oberweis, Wiesbaden: Reichert Verlag 2021, S. 95–115 (urn:nbn:de:bsz:16-heidok-234974).
- Das genealogische Reimgedicht in der Wernau’schen Chronik (1592) des Valentin Salomon von Fulda. Überlegungen zur Frage nach der inschriftlichen Ausführung, in: Literatur und Epigraphik. Phänomene der Inschriftlichkeit in Mittelalter und Früher Neuzeit. Hg. von Laura Velte und Ludger Lieb (Philologische Studien und Quellen 285). Berlin 2022, S. 313–374 (https://doi.org/10.37307/b.978-3-503-20906-4.18)
- Intentionen und Inhalte mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Glockeninschriften im deutschsprachigen Raum, in: Archiv für Epigraphik 3 (2023) S. 13–74 (urn:nbn:de:bsz:15-qucosa2-884706).
- Das Stiftergrabmal für Bischof Günther von Speyer. Die Inschrift und ihre Datierung, in: Matthias Untermann, Die Kirche der Zisterzienserklosters Maulbronn. Die Ostteile, hg. v. Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart (Forschungen und Berichte der Bau- und Kunstdenkmalpflege in Baden-Württemberg 20), Esslingen 2024, Bd. 1, 235–238.
- Die Grabmäler für die Bischöfe Günther und Ulrich I. von Speyer im Sanktuarium der Klosterkirche. Beobachtungen und Überlegungen zu Abfolge und ehemaliger Aufstellung, in: ebd., Bd. 1, 238–244.
- Neues Stiftergedenken. Die Inschriften, in: ebd., Bd. 1, 323–325.
- Die Inschriften am und im Ostwerk der Maulbronner Klosterkirche, in: ebd., Bd. 2, 721–797.
- Der Kaiserzyklus im Rittersaal des Köngener Schlosses. Seine Neudatierung nach den Vorlagen, in: Schwäbische Heimat. Magazin für Geschichte, Landeskultur, Naturschutz und Denkmalpflege 75 (2024) H. 3, 63–71 (https://doi.org/10.53458/sh.v75i3).
- B S. Zwei Zierinitialen an einem schwäbischen Kirchenbau. Zum Einfluß gotischer Schreibtraditionen auf die Steinmetzkunst in Oberlenningen (Lkr. Esslingen), in: Archiv für Epigraphik 4 (2024) 17–24 (urn:nbn:de:bsz:15-qucosa2-938491).
- Diepolds rätselhafte Grabschrift, in: Archiv für Epigraphik 5,2 (2025) 29–42 (https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:15-qucosa2-1011536).
Vorträge:
- Die Inschriften der Pfarrkirche zu Esperstedt (Tag der Heimatpflege im Lkr. Merseburg-Querfurt, April 1999, Obhausen).
- Die Inschriften der Heidelberger Peterskirche (Schulungskurs für Touristenführer, März 2006, ausgerichtet vom ev. Pfarramt der Peterskirche Heidelberg).
- Erträge aus der Bearbeitung der Inschriften im ehemaligen Landkreises Querfurt (Vortrag anläßlich der öffentlichen Buchpräsentation „Die Inschriften des Landkreises ehemaligen Landkreises Querfurt“, 13.5.2006, Burg Querfurt).
- Konventionen des antiken Herrscherlobes in frühneuzeitlichen Inschriften (11. Internationale Fachtagung für Epigraphik vom 9. bis 12. Mai 2007, ausgerichtet von der Arbeitsstelle Inschriften der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen am Historischen Institut der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Alfried-Krupp-Wissenschaftskolleg).
- (gemeinsam mit Harald Drös), Epigraphische Spurensuche. Inschriften des Mittelalters und der Frühen Neuzeit als Schriftdenkmäler und historische Quellen (Vortragsreihe der Mitarbeiter der Heidelberger Akademie der Wissenschaften „Wir forschen für Sie“, 24.6.2008, Praktisch-Theologisches Seminar der Theologischen Fakultät Heidelberg).
- Die Wiederherstellung der markgräflich badischen Grablege in der Stiftskirche der Stadt Baden nach ihrer Zerstörung von 1689 (Vortragsreihe der Arbeitsgemeinschaft für geschichtliche Landeskunde am Oberrhein e.V., 16.01.2009, Karlsruhe, Generallandesarchiv, vgl. Protokoll der Arbeitssitzung 483/2009).
- Die Grablege der Markgrafen von Baden im Kloster Lichtenthal (Baden-Baden) nach der Wiederherstellung von 1828/32. Form und Funktion der Gotischen Majuskel aus der Steinmetzwerkstatt Johann Belzers zu Weisenbach (Lkr. Rastatt) (12. Internationale Fachtagung für Epigraphik vom 5. bis 8. Mai 2010, ausgerichtet von der Forschungsstelle Die Deutschen Inschriften an der Mainzer Akademie der Wissenschaften und der Literatur).
- Jubelschall und Totenklage – Die Funktionen mittelalterlicher Glocken im Spiegel ihrer Inschriften (Vortragsreihe der Mitarbeiter der Heidelberger Akademie der Wissenschaften „Wir forschen für Sie“, 23.5.2012, Heidelberger Akademie der Wissenschaften).
- Spätmittelalterliche Inschriften lesen – verstehen – transkribieren (Einführungsvortrag zur mittelalterlichen Epigraphik im Rahmen der Interdisziplinären Sommerkurse „Inschrift – Handschrift – Buchdruck. Medien der Schriftkultur im späten Mittelalter“, Greifswald vom 21.–27.9.2014, vom 19.-23.6.2023 und vom 25.–29.8.2025, ausgerichtet von der Arbeitsstelle Inschriften der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen am Historischen Institut der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Alfried Krupp Wissenschaftskolleg Greifswald).
- Zeitgenossen aus vergangenen Tagen – Nahaufnahmen historischer Inschriften aus dem Landkreis Freudenstadt (Vortrag anläßlich der öffentlichen Buchpräsentation „Die Inschriften des Landkreises Freudenstadt“, 10.2.2017, Stadthaus Freudenstadt).
- Die Inschriften des Landkreises Esslingen – ein Projekt der Forschungsstelle Deutsche Inschriften an der Heidelberger Akademie der Wissenschaften (Vortrag vor dem Esslinger Geschichts- und Altertums, 7.12.2017, Stadtmuseum Esslingen).
- Das genealogische Reimgedicht in der Wernau’schen Chronik (1592) des Valentin Salomon von Fulda – Überlegungen zur Frage nach der inschriftlichen Ausführung (Tagung „Reale und fiktive Inschriften in Mittelalter und Früher Neuzeit“, ausgerichtet vom SFB 933 „Materiale Textkulturen“, TP C05 „Inschriftlichkeit. Reflexionen materialer Textkultur in der Literatur des 12. bis 17. Jahrhunderts“, Prof. Dr. Ludger Lieb, Laura Velte, Dennis Disselhoff, 5.10.2020–7.10.2020, Germanistisches Seminar Heidelberg).
- Der Pforzheimer Rathaushof als stadtgeschichtliche Fundgrube – Ansätze und Wege zur Deutung fragmentierter Inschriften (Vortrag in der Reihe „Montagabend im Archiv“, ausgerichtet vom Stadtarchiv Pforzheim und der Löblichen Singergesellschaft von 1501 Pforzheim, 5.7.2021, online: www.youtube.com/watch?v=P09o65__zyA).
- O Mensch bedencke Dich – Schwör ja nicht Frevendtlich! Die Textvorlagen für die Beschriftung der frühneuzeitlichen Eidtafel zu Filderstadt-Sielmingen (Texttransfer und intertextuelle Bezüge in den Inschriften des Mittelalters und der Frühen Neuzeit. 16. Internationale Fachtagung für mittelalterliche und frühneuzeitliche Epigraphik vom 7. bis 9. Oktober 2024, ausgerichtet von der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, 8.10.2024, Hauptgebäude Leipzig).
- Das Tympanon über dem Westportal der Alpirsbacher Klosterkirche. Datierungsindizien aus dem epigrafischen, ikonografischen und stilistischen Befund (Vortrag am 25. Juni 2025 im Rahmen der Tagung: Kloster Alpirsbach. Im Fokus der aktuellen Wissenschaft. Tagung vom 23. bis 25. Juni 2025 in der Kirche von Kloster Alpirsbach, ausgerichtet von Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg in Kooperation mit dem Kunsthistorischen Institut der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel).
- Verborgen – verloren – verkannt: Neue Forschungsergebnisse zu Nürtinger Inschriften der Frühen Neuzeit (Vortrag am 6. Oktober 2025 im Chor der Nürtinger Stadtkirche auf Einladung des Schwäbischen Heimatbundes, Regionalgruppe Nürtingen, in Kooperation mit der Ev. Kirchengemeinde, der Volkshochschule, des Stadtmuseums und des Stadtarchivs Nürtingen).