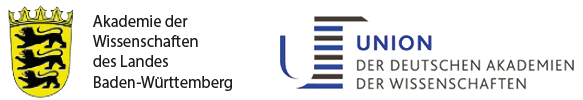Bevor der Mensch sich aus Afrika nach Eurasien und darüber hinaus verbreitete, erweiterte er seine ökologische Nische um die afrikanischen Wälder und Wüsten, wie neue Forschungsergebnisse zeigen. Die Autorinnen und Autoren einer neuen Studie argumentieren, dass dieser Anpassungsprozess an schwierige Lebensräume entscheidend für die langfristig erfolgreiche Ausbreitung des Menschen war.
Heute weiß man, dass alle Nicht-Afrikaner von einer kleinen Gruppe von Menschen abstammen, die sich vor etwa 50.000 Jahren nach Eurasien wagten. Frühere Menschenfunde außerhalb Afrikas zeigen jedoch, dass es vor dieser Zeit zahlreiche gescheiterte Ausbreitungsversuche gab, die keine erkennbaren genetischen Spuren bei heute lebenden Menschen hinterlassen haben.
Eine neue Studie in der Fachzeitschrift Nature erklärt nun erstmals, warum diese frühen Wanderungsversuche nicht gelangen. Dabei zeigt ein Team von Forschenden unter der Leitung von Professorin Eleanor Scerri vom Max-Planck-Institut für Geoanthropologie in Jena und Professor Andrea Manica von der Universität Cambridge, dass die Menschen vor ihrer Ausbreitung nach Eurasien vor 50.000 Jahren begannen, verschiedene Arten von Habitaten in Afrika auf bislang unbekannte Weise zu erschließen. Für die notwendige archäologische Datenbasis dieser Analyse werteten beteiligte Forscher der Universität Tübingen Informationen aus der Datenbank ROAD des Heidelberger Akademie-Projektes „The Role of Culture in Early Expansions of Humans (ROCEEH)“ aus.
„Wir stellten einen Datensatz aus archäologischen Stätten und Umweltdaten in Afrika zusammen, der die letzten 120.000 Jahre abdeckt. Mithilfe von Methoden aus der Ökologie versuchten wir, die Veränderungen in den ökologischen Nischen des Menschen, also die ihm nutzbaren und förderlichen Lebensräume, nachzuvollziehen“, sagt Dr. Emily Hallet, die Erstautorin der Studie von der Loyola University Chicago.
„Unsere Ergebnisse zeigen, dass der Mensch seine Nische vor 70.000 Jahren signifikant ausdehnte, was durch eine verstärkte Nutzung verschiedener Habitate, wie Wäldern und Wüsten, angetrieben wurde“, fügt Dr. Michela Leonardi, eine der Hauptautorinnen der Studie vom Natural History Museum in London, hinzu.
„Das ist ein Schlüsselergebnis. Vorherige Ausbreitungen geschahen vermutlich während günstiger Zeitfenster mit vermehrten Niederschlägen in der Arabische Wüste, wodurch ‚grüne Korridore‘ für die Menschen entstanden, um nach Eurasien zu gelangen. Vor etwa 70.000 bis 50.000 Jahren war der einfachste Weg aus Afrika jedoch schwieriger als in früheren Perioden, und dennoch war diese Ausbreitung beträchtlich und letztlich erfolgreich“, erklärt Professor Manica.
Für die langfristig nur einmalig erfolgreiche Verbreitung des Menschen aus Afrika wurden viele Erklärungsversuche aufgestellt, von technologischen Schlüsselinnovationen wie Pfeil und Bogen oder Gehirnveränderungen bis hin zu Immunität gegen Krankheiten durch eine Vermischung mit eurasischen Menschenformen. „Die Suche nach einer einzelnen bahnbrechenden Innovation des Menschen oder einer revolutionären Veränderung in dessen Kognition, die die erfolgreichen Auswanderungsbewegungen ermöglicht hat, haben bisher alle ins Leere geführt“, ergänzt PD Dr. Manuel Will, Ko-Autor der Studie von der Universität Tübingen.
Hier zeigen die Forschenden jedoch, dass der Mensch das ihm zur Verfügung stehende Spektrum an Lebensräumen in Afrika, vor seiner Ausbreitung über den Kontinent hinaus, stark vergrößerte. Diese Ausweitung der menschlichen Nische war möglicherweise das Ergebnis einer positiven Rückkopplung durch vermehrte Kontakte und kulturellen Austausch, was größere Verbreitungsgebiete und die Überwindung geografischer Barrieren ermöglichte.
„Anders als frühere Menschen, die sich aus Afrika ausbreiteten, verfügten diese Gruppen, die vor etwa 60.000 bis 50.000 Jahren nach Eurasien zogen, über eine ausgeprägte ökologische Flexibilität, um mit klimatisch schwierigen Lebensräumen zurechtzukommen“, so Professorin Scerri, „Dies war wahrscheinlich der entscheidende Mechanismus für den Anpassungserfolg unserer Spezies außerhalb ihrer afrikanischen Heimat.“
Die Forschung wurde finanziell unterstützt durch die Max-Planck-Gesellschaft, den europäischen Forschungsrat und den Leverhulme Trust. Das ROCEEH Projekt wird durch die Heidelberger Akademie der Wissenschaften gefördert.
Nach einer Pressemitteilung des Max-Planck-Instituts für Geoanthropologie/Hochschulkommunikation der Universität Tübingen.
Publikation:
Emily Y. Hallett, Michela Leonardi, Jacopo Niccolò Cerasoni, Manuel Will, Robert Beyer, Mario Krapp, Andrew W. Kandel, Andrea Manica, Eleanor M.L. Scerri: Major expansion in the human niche preceded out of Africa dispersal.
Nature, https://doi.org/10.1038/s41586-025-09154-0
Kontakt an der Universität Tübingen:
Dr. Andrew Kandel, ROCEEH, a.kandel@uni-tuebingen.de