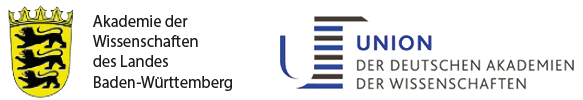Vorwort
Die Heidelberger Akademie der Wissenschaften hat die Aufgabe, in einem ständigen wissenschaftlichen Austausch unter ihren Mitgliedern neue wissenschaftliche Fragen zu entwickeln, Lösungsmöglichkeiten anzubieten, den Dialog und die Zusammenarbeit mit Nachwuchswissenschaftlern besonders zu pflegen. Dabei stellen die Fortschritte der Wissenschaft in der Gegenwart gänzlich neue Fragen an die Akademie, die das kulturelle Erbe unserer Gesellschaft zu bewahren und für die Gegenwart zu erschließen, das Gespräch insbesondere zwischen Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften zu vermitteln, der Politik und der Öffentlichkeit Entscheidungshilfen anbieten soll. Die Mitglieder der Heidelberger Akademie sehen sich deshalb veranlasst, sich ihres Auftrags, ihrer Wissenschaftsverantwortung und ihrer Wirkungsmöglichkeiten erneut zu vergewissern. Das Ergebnis ist in dieser Statusschrift festgehalten, die wir nunmehr der Öffentlichkeit vorlegen.
Heidelberg, im November 2013
Prof. Dr. Paul Kirchhof
1. Auftrag
Die Heidelberger Akademie der Wissenschaften ist eine Gemeinschaft von Gelehrten*, die in stetigem fachlichen Austausch ihre unterschiedlichen Wissenschaftskulturen zusammenführen, Leitgedanken des Wissenschaftlichen entwickeln, in der Begegnung der Disziplinen Neues entdecken wollen. Die Heidelberger Akademie pflegt den fächerübergreifenden Dialog, die generationenübergreifende Forschung, den Austausch zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit. Die Akademie und ihre Mitglieder schaffen ein Forum für die Einheit der Wissenschaften, die in einer Zeit der Spezialisierungen zurückgewonnen werden muss. Die Wissenschaft erzielt durch Aufteilung in viele Teildisziplinen große Erkenntnisgewinne, braucht aber in dieser Arbeitsteilung einen Ort der Begegnung, um in Kombination der Ergebnisse und der methodischen Ansätze Erfahrungen auszutauschen, Sichtweisen zu weiten, neue Beobachtungen und Einsichten zu erschließen. Nur so werden ganzheitliche, wissenschaftlich solide Antworten auf die Anfragen einer komplexen Welt gelingen. Ein solcher Ort der Begegnung ist die Heidelberger Akademie. Die Heidelberger Akademie schlägt Brücken zwischen den Universitäten und Wissenschaftsinstitutionen in Baden-Württemberg. Sie ist die wohl einzige Institution des Landes, in der die großen wissenschaftlichen Erfolge seiner Universitäten und Forschungseinrichtungen gemeinsam genutzt werden, herausragende Köpfe in persönlichen Gesprächen wie in gemeinsamen Forschungsprojekten zusammenwirken. Die Heidelberger Akademie der Wissenschaften wurde 1909 aus privaten Mitteln gegründet, um die bereits damals bestehende Kluft zwischen Geistes- und Naturwissenschaften zu überwinden. Inzwischen hat sich die Wissenschaft erheblich weiter untergliedert und läuft Gefahr, sich in ihren Einzeldisziplinen fremd zu werden. Um dem entgegenzuwirken, vereint die Akademie Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaftler sowie Natur-, Lebens- und Ingenieurswissenschaftler. Die beiden Klassen der Akademie – die Philosophisch-historische die Mathematisch-naturwissenschaftliche – wollen in gemeinsamer wissenschaftlicher Anstrengung grundsätzliche Gegenwarts- und Zukunftsfragen erörtert und Lösungsvorschläge unterbreiten. Die Akademie ist – wiederum wohl als einzige Wissenschaftseinrichtung in Baden-Württemberg – offen für alle Fachdisziplinen. In kritischer Selbstbesinnung wird sie sich auch künftig personell so erneuern, dass die in Baden-Württemberg gelebte fachliche Vielfalt und inhaltliche Pluralität der Wissenschaften in der Akademie aufeinandertreffen. Sie überprüft die Praxis der Zuwahlen ihrer Mitglieder beständig, insbesondere um das Zusammenwirken der Fachdisziplinen in ihrer Vielfalt, der jüngeren und älteren Mitglieder, der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen zu pflegen. Die Heidelberger Akademie der Wissenschaften will die politischen Kontroversen der Gegenwart mit ihrem wissenschaftlichen Rat begleiten, versteht sich aber in ihrem Auftrag zur Grundlagenforschung vor allem als Forum für die wissenschaftlich begründete Erörterung verschiedener Lösungsstrategien. In ihrer Verantwortung für die Einheit der Wissenschaft und für das wissenschaftliche Zusammenwirken in Vielfalt arbeitet die Heidelberger Akademie in unterschiedlichen, wissenschaftlich eng verzahnten Gremien und Vorhaben:
- In Klassen- und Plenarversammlungen werden Forschungen der Mitglieder vorgestellt und diskutiert. Hinzu treten interdisziplinäre Arbeitsgruppen zu zentralen, fächerübergreifenden Grundsatzproblemen. Der Austausch über die Grenzen von Fächern oder Klassen hinweg bietet die Chance, disziplinäre Engführungen kritisch zu überdenken und zu neuen disziplinübergreifenden Fragestellungen und Lösungsstrategien vorzudringen. Dieser Mehrwert erwächst aus der persönlichen Begegnung, die in der Akademie einen besonderen institutionellen Rahmen findet. Die Akademie bietet Raum für das Unerwartete, für das überraschte Staunen, für das wissenschaftliche Suchen jenseits routinierter Wissenschaftsabläufe, für die neue Erkenntnis, die sich gerade in Grenzgebieten der Wissenschaften erschließt.
- Das Akademienprogramm von Bund und Ländern ermöglicht Nachhaltigkeitsprojekte, die nicht dem Rhythmus von individuellen Qualifikationsarbeiten – angelegt auf 3 bis 6 Jahre – folgen, wie er in der Finanzplanung, in Berichtspflichten, Verwendungs- und Erfolgsnachweisen sowie Evaluationen angelegt ist. Die Zeitperspektiven werden durch den Untersuchungsgegenstand und nicht vom Arbeitsrhythmus eines Einzelforschers bestimmt. Die DFG hat diese Langzeitprojekte aus ihrer Förderung ausgeschlossen und dem Akademienprogramm zugewiesen. In dieser Nachhaltigkeitswirkung ist die kulturelle und wissenschaftliche Bedeutung der Langzeitprojekte angelegt, ihre Finanzierung auf lange Zeit begründet.
- Die Heidelberger Akademie arbeitet an Projekten zu Grundlagen- und Schwerpunktthemen kultur- und geisteswissenschaftlicher Forschung, von der Erforschung des Beginns der Menschheitsgeschichte über die Bewahrung, Dokumentation, Erforschung und Erschließung des kulturellen Erbes mehrerer Jahrtausende bis zur kulturellen Neuorientierung der Gegenwart. Die wissenschaftliche Qualifikation ihrer Mitglieder, die Begleitung der mehr als zwanzig nachhaltigen Forschungsprojekte oft über eine Wissenschaftsgeneration hinaus, die Förderung durch öffentliche Forschungsmittel verpflichtet die Heidelberger Akademie zur thematischen Strukturierung interdisziplinärer Forschung und zur Nachwuchsförderung. Mit der Entwicklung neuer Projekte öffnet die Akademie gerade jungen Wissenschaftlern eine herausragende Chance, sich innovative Forschungsfelder anzueignen und zu nutzen. Die Akademie sucht gegenwärtig vermehrt Brücken zwischen Wissenschaftskulturen zu schlagen und dadurch Nachwuchswissenschaftlern Raum für neue Forschungsideen zu bieten.
- Wissenschaftsfreiheit setzt Freiheitsvertrauen voraus, braucht den Wissenschaftler, der dank eines mehrstufigen Qualifikationsverfahrens seine Fähigkeit und Bereitschaft zu wissenschaftlichem Arbeiten nachgewiesen, in den Universitäten und in seinem Fach Anerkennung gefunden hat. Die Heidelberger Akademie ist auch eine Institution dieses Freiheitsvertrauens. Sie setzt auf die Exzellenz ihrer Mitglieder, auf die Qualität ihrer Projekte, auf die Sachkunde und Unbefangenheit der Projektleiter, Mitarbeiter und Evaluatoren. Die Erfolge der Akademie bestätigen dieses Freiheitskonzept.
2. Landesakademie
Rang, Wirtschaftskraft und politischer Einfluss eines Landes hängen wesentlich von seiner wissenschaftlichen Kraft und technischen Leistungsfähigkeit ab. Die Heidelberger Akademie der Wissenschaften ist eine Akademie des Landes, dessen wissenschaftliche Leistungsfähigkeit in der Gegenwart herausragt und in der Tradition ihrer Universitäten Freiburg, Heidelberg, Hohenheim, Karlsruhe, Konstanz, Mannheim, Stuttgart, Tübingen, Ulm fundiert ist. Das Land Baden-Württemberg ist mit mehr als zehn Millionen Einwohnern europäischen Mittelstaaten wie Österreich, Belgien, Tschechien oder Ungarn vergleichbar. Es gehört wirtschaftlich, kulturell und wissenschaftlich zu den führenden Regionen Europas. Deshalb ist für Baden-Württemberg – wie für die genannten europäischen Mittelstaaten – eine eigene Akademie selbstverständlich. Gerade ein Land mit besonders leistungsfähigen Universitäten, mit erfindungsreichen innovativen mittelständischen Unternehmen, mit einer auf Forschung und Entwicklung bedachten Industrie braucht einen solchen Ort wissenschaftlicher Integration, in dem Medizin, Technik, Natur-, Geistes- und Kulturwissenschaften zusammen wirken, sich gegenseitig befragen, bisherige Forschungsinhalt und Forschungsmethoden infrage stellen und die Zukunftsfragen an die Wissenschaft vorauszusehen und zu beantworten suchen. Diese disziplinübergreifenden Einsichten in die Wissenschaft sind auch für das öffentliche Schul- und Erziehungswesen unerlässlich Besonders fruchtbar ist diese Zusammenarbeit in Forschungsprojekten, die das kulturelle Erbe des Landes Baden-Württemberg sichten, bewahren und für die Gegenwart erschließen. Editionen der Werke bedeutender Landeskinder machen jene Materialien zugänglich, die eine reiche Kulturtradition belegen, als eine das Land und seine Demokratie prägende Grundlage verständlich und bewusst werden lassen. Die Heidelberger Akademie ist Teil der baden-württembergischen Wissenschaftslandschaft, wird durch ihre auswärtigen Sitzungen in allen Teilen des Landes sichtbar, wirkt über die Grenzen des Landes, Deutschlands und Europas hinaus. Die Akademie ist mit korrespondierenden Mitgliedern aus anderen Ländern und auswärtigen Angehörigen der wissenschaftlichen Projektkommissionen verbunden. Sie erfüllt ihre Aufgaben im Kreis der acht deutschen regionalen Akademien und in enger Bindung zu Forschungseinrichtungen des In- und Auslands. Sie trägt wesentlich dazu bei, dass der Wissenschaftsstandort im Südwesten Deutschlands durch landesweite Zusammenarbeit gestärkt, durch inhaltliche Anregung der verschiedenen Fachdisziplinen ausgebaut und als Anziehungspunkt bedeutender Gelehrter aus aller Welt gesucht wird.
3. Begegnung der Fachdisziplinen
Der Akademiegedanke fordert, die Probleme der technischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Moderne in neuen Begegnungsformen wissenschaftlich zu lösen. Je mehr die Verkehrstechnik sich entwickelt, desto größer werden die von ihr verursachten Umweltgefahren. Je weiter die Medien ihre Informationen verbreiten, desto mehr wächst deren Einfluss auf die Freiheit des Menschen. Je intensiver auch personenbezogene Daten gesammelt und verwertet werden, desto mehr ist die Privatsphäre berührt. Fortschritte insbesondere von Medizin und Technik verursachen Nebenfolgen, die beobachtet, verstanden, kontrolliert und eingeschränkt werden müssen. Die Probleme von Lebenswissenschaften, Naturwissenschaften und Technik müssen durch Wissenschaftler gelöst werden. Die Gefahren des wissenschaftlich technischen Fortschritts kann nur abwehren, nachteilige Folgen nur mäßigen, wer diese Abläufe und Wirkungen versteht, zu beherrschen und der Gesellschaft zu vermitteln weiß. Natur-, Wirtschafts-, Sozial- und Kulturwissenschaften müssen zusammenwirken, um neue, im wissenschaftlichen Fortschritt angelegte Fragen vorauszusehen, Fehlsteuerungen von Politik, Wirtschaft und Kultur kritisch zu analysieren. Deswegen brauchen wir einen Ort, an dem führende Vertreter der Einzeldisziplinen ihre teilweise unterschiedlichen Sichtweisen austauschen, fachübergreifende Probleme unabhängig von politischen Erwartungen und interessengebundenen Vorgaben diskutieren. Oft wirkt der wissenschaftliche Austausch unter den Fachdisziplinen wie ein Katalysator, der Fehlvorstellungen, die aus Spezialisierungen und methodischen Engführungen entstehen, ausräumt, vermeintliche Sicherheit in Nachdenklichkeit verwandelt, den Blick vom Detail zum Ganzen wendet. Die Selbstverwaltung einer Akademie bietet bewährte Formen von Forschung und Publikation, die eine Gediegenheit erprobten Wissens, die Verlässlichkeit einer wissenschaftlich fundierten Voraussage, die Nachdenklichkeit einer bloßen Vermutung in öffentliche und parlamentarische Diskussionen hineintragen. Die Mitglieder der Akademie sind Spezialisten ihres Fachs, sind sich dabei aber stets bewusst, dass die Spezialisierung es erschwert, angemessene Antworten auf fächerübergreifende Fragen zu finden. Sie suchen deshalb in der Akademie das interdisziplinäre, sachorientierte Gespräch, bringen in die Akademiearbeit eine in Forschung und Lehre erprobte Unabhängigkeit, drängen auf weitere Erfahrungen, Daten, Einsichten, Deutungen, die auch das eigene Fach fortentwickeln. So entstehen neue Disziplinen. Traditionelle Wissenschaften erweitern und korrigieren ihre Sichtweisen. Erfahrene und junge Wissenschaftler finden in gemeinsamen Arbeitsgruppen und Fragestellungen zusammen. Die Akademien bieten im stetigen Fluss der Wissenschaft einen Fixpunkt, an dem sich heraus ragende Wissenschaftler sammeln, um ihre Fragen miteinander zu prüfen, ihre Arbeitsmethoden zu erneuern, ihre Ergebnisse auszutauschen und gemeinsam neue Erkenntnisse zu suchen.
4. Nachhaltigkeit
Die Politik will das gesellschaftliche Leben, den Umgang mit der Natur und die Entfaltung humaner Werte nachhaltig weiterentwickeln und erwartet dabei Unterstützung durch die Wissenschaft. Die Grundbedürfnisse aller Menschen sollen befriedigt, ihre Lebensqualität verbessert, die Idee von Frieden, Menschen würde und Freiheit über die Generationen hinaus weltweit verbreitet werden. Dabei hilft die Wissenschaft, die Welt zu verstehen, indem sie methodisch kontrolliert und dem Menschen verpflichtet Wissen gewinnt und bereitstellt. Das Gedankengebäude der Wissenschaft ist niemals unangreifbar vollendet, bewahrt seine Festigkeit in stetiger Berichtigung von Irrtümern, strebt danach, sich mit langem Atem immer mehr der Wahrheit zu nähern. Diese Wissenschaft braucht nach ihrem zukunftsgerichteten, generationenübergreifenden Anspruch eine nachhaltig organisierte Forschung. In einer schnelllebigen Zeit, in der die Politik ihren Blick auf die Wahlperioden, die Industrie auf den Quartalsbericht, die Börsen auf den Tageskurs richten, sucht die Wissenschaft Erkenntnisse und Einsichten, die aktuelle Trends überdauern, der Gegenwart langfristige Perspektiven vermitteln, das Wissen in Kontinuität – nach gesicherten Methoden und verlässlichen Prinzipien – erneuern. Wie der Forstwirt heute einen Baum pflanzt, der allenfalls seinem Enkel wirtschaftlich zugutekommt, damit aber eine naturgerechte Umwelt sichert, so schafft auch die Wissenschaft nachhaltige Werte, die weit über den Tag hinausgreifend geistige Lebensgrundlagen, Erfahrungen, Ideen und Gemeinschaftsentwürfe erhalten und erneuern. Diese Nachhaltigkeit wird in der Akademie der Wissenschaften besonders gepflegt. Sie bietet den Raum, in dem langjährige kontinuierliche Beobachtungen und Erhebungen möglich sind, Datensammlungen für Editionen umfangreicher Textcorpora und Lexika erarbeitet und für die Öffentlichkeit bereitgestellt werden. Diese Arbeiten überschreiten häufig die Arbeitskraft und Lebenszeit eines einzelnen Forschers, machen eine fächerübergreifende Zusammenarbeit von Gelehrten erforderlich. Diesen Ort der Nachhaltigkeit bieten in der internationalen Wissenschaftslandschaft nur die Akademien der Wissenschaften und die von ihnen getragenen Forschungsvorhaben. Die Akademien schaffen, wenn sie Natur und Umwelt in einem generationenübergreifenden Anspruch erforschen, das kulturelle Erbe erschließen, sichern und vergegenwärtigen, Datenbanken stetig weiterentwickeln, einen Wissensspeicher, auf den künftige Generationen aufbauen können. Akademien prägen mit ihren Nachhaltigkeitsvorhaben auch ihr wissenschaftliches Umfeld. Die Forschungsprojekte werden von Expertenkommissionen kritisch-konstruktiv begleitet. Die Projekte brauchen und suchen die internationale Zusammenarbeit. Erfahrene Wissenschaftler, ausgewiesene Spezialisten führen Nachwuchswissenschaftler in die Materie ein. Gleichzeitig bringen junge Forscher mit ihrer Lebens- und Wissenschaftssicht neue Perspektiven in die Vorhaben der Akademie. So entstehen Kompetenzzentren, die ständig neue Fragen stellen, nachhaltige Forschung anstoßen, für Kultur, Wirtschaft und Staat verlässliche Beurteilungs- und Handlungsperspektiven entwickeln und fortschreiben.
5. Grundlagenforschung
Eine auf nachhaltige Wirkung bedachte, die Grundbedürfnisse aller Menschen befriedigende, die Lebensqualität der Gegenwart und der folgenden Generationen verbessernde Wissenschaft ist darauf angelegt, die Grundlagen menschlichen Handelns und Denkens zu erkunden und zu verstehen. Große Gedanken waren stets Antrieb zu grundlegenden Reformen, in der Moderne insbesondere die Idee der Menschenrechte und des Weltfriedens, die Fortschritte der Medizin, der Produktions-, der Verkehrs- und Medientechniken. Die Heidelberger Akademie widmet sich in der Vielfalt ihrer Wissenschaften dieser Grundlagenforschung, schlägt dabei Brücken zwischen den verschiedenen Universitäten und Forschungseinrichtungen insbesondere in Baden-¬Württemberg Sie begreift das Entstehen und den Wandel von Kulturen in Sprache, versteht die Gegenwart des Sprechens aus der Herkunft der Sprache, erkennt in der Übereinkunft dank Sprache eine Grundlage für den Zusammenhalt von Kulturen und Demokratien. Die Akademie macht in sprachwissenschaftlichen und historischen Nachhaltigkeitsprojekten bewusst, wie der Mensch seine Fähigkeit zum Beobachten und Erfahren, zum Vergleichen und Bewerten, zum Ordnen und Verstehen, zum Begegnen und Mitteilen, zum Tauschen und Vereinbaren, zum gemeinsamen und gemeinschaftlichen Handeln entwickelt. Die Heidelberger Akademie erforscht vergangene Schreib- und Sprachkulturen, ordnet und deutet die Kulturen verschiedener Lebensbereiche und Regionen, gibt dem gegenwärtigen Wissen und Denken Fundament und Verlässlichkeit, macht bewusst, dass die oft nur fragmentarischen Dokumente im Kontext ihres Entstehens und unserer kulturellen Gegenwart verstanden werden müssen. Die Naturwissenschaften erfassen die Welt in der Präzision der Zahl, der Messbarkeit, dem Erheben und Kombinieren von Daten. Natur- und Geisteswissenschaften begegnen sich im Grundsätzlichen, wenn sie Ziel und Methode ihres Experiments kritisch hinterfragen, prüfen, was die Zahl offenbart oder verbirgt, wie menschliches Handeln und kulturelle Eigenart gemessen und verstanden werden müssen. Deswegen stellt sich die Akademie in Zusammenwirken und Unterschiedlichkeit der Disziplinen der Frage, inwieweit die Wissenschaft die Welt messen und zählen kann, inwieweit sie die Welt verstehen und ergründen muss. Die Akademie ist der Ort, an dem Grundlagenfragen in der Rationalität von Ursache und Wirkung, von Versuch und Irrtum, von Widerlegen und Bestätigung rational beantwortet werden. Grundlagenforschung ist für alle Folgen offen, die wissenschaftliches Handeln für den Menschen haben kann. Die Heidelberger Akademie pflegt diese Offenheit nicht in der Vielfalt von Fakultäten, sondern zwischen zwei Klassen. Beide Klassen begegnen sich in ihrem jeweiligen Erfahrungswissen, dem Denken „im Raum der Ursachen“, und ihrem Orientierungswissen, dem Denken im „Raum der Gründe“. Das regelmäßige Eintreten in diese beiden Räume gibt allen Mitgliedern der Akademie die Möglichkeit, ein Stück der Natur zu ermessen und zu verstehen, die Bedeutung des Menschen und seiner Umwelt zu ergründen, seine Lebensformen und Lebensmaximen zu erklären, auch zu rechtfertigen, vertraute, aber langfristig schädliche Verhaltensweisen zu verändern. Die Akademie ist institutionell und personell darauf angelegt, ein Ort gedanklicher Weite, des Fragens, nachhaltigen Denkens, besonderer Zukunftsverantwortung zu sein.
6. Qualitätsanspruch
Wissenschaft strebt nach dem Besseren, hofft heute den Erkenntnissen von gestern neue hinzuzufügen, auch den bisherigen Irrtum zu berichtigen. Dem entsprechend werden Wissenschaftler nach ihrer fachlichen Qualifikation, ihrer Erneuerungskraft, ihrer Offenheit für stetige Selbstkritik und wissenschaftliche Zusammenarbeit ausgewählt. Das gilt insbesondere für die Maßstäbe, nach denen die Mitglieder der Heidelberger Akademie der Wissenschaften berufen werden. Vorschläge für neue Mitglieder werden in einem mehrstufigen Auswahlprozess geprüft und durch das Plenum der Mitglieder beider Klassen gewählt. Bisher wurden 31 Mitglieder der Heidelberger Akademie der Wissenschaften mit dem Nobel-Preis (27) und dem Balzan-Preis (4) ausgezeichnet. Davon sind neun heute noch aktiv. Hinzu kommen 41 Inhaber des Ordens Pour Le Mérite, 30 Preisträger des Leibniz-Preises und 16 Preisträger des Landesforschungspreis Baden-Württemberg. Diese Zahlen und weitere Auszeichnungen, die Mitglieder der Akademie entgegengenommen haben, sind Ansporn, die wissenschaftliche Exzellenz bei jeder Auswahl eines Mitglieds langfristig zu sichern, die Fächervielfalt in den Wissenschaftsstandorten Baden-Württembergs zu berücksichtigen Der hohe wissenschaftliche Anspruch bestimmt auch die Projekte der Akademie. Neue Projektvorschläge werden nach externer Begutachtung in einer multidisziplinär zusammengesetzten Kommission geprüft und der Union der Akademien im Rahmen des Akademienprogramms von Bund und Ländern vor geschlagen. Die Höhe der eingeworbenen Drittmittel der Akademie übersteigt ihre Grundfinanzierung um mehr als das Dreifache. Die geförderten Projekte werden regelmäßig durch wissenschaftliche Kommissionen in der Qualität ihres Auftrags, dem Forschungsfortschritt und der Zukunftserwartung überprüft. Die Projekte werden in regelmäßigen Abständen extern evaluiert.
7. Wissenschaftlicher Nachwuchs
Die wissenschaftliche Exzellenz setzt bereits bei der Nachwuchsförderung an. Die Heidelberger Akademie hat mit Unterstützung des Landes Baden-Württemberg eine bundesweit einmalige Initiative entfaltet, die landesweit den besten Nachwuchswissenschaftlern eine Möglichkeit der Förderung bietet. Die Akademie finanziert jungen Wissenschaftlern interdisziplinär ausgerichtete Projekte, eröffnet dadurch einen besonderen Freiraum für Forschungen und ermöglicht den Austausch mit Akademiemitgliedern. So trägt die Heidelberger Akademie dazu bei, Baden-Württemberg als Standort für junge Wissenschaftler, als Ausgangspunkt für zukunftsweisende Wissenschaftsprojekte noch attraktiver zu machen.
- Im Jahr 2002 hat die Heidelberger Akademie mit Unterstützung des Landes Baden-Württemberg das wissenschaftliche Nachwuchskolleg (WIN-Kolleg) eingerichtet, um den wissenschaftlichen Nachwuchs in Bade Württemberg durch Zugehörigkeit und Nähe zur Akademie zu fördern, deren Projekte zu unterstützen, die interdisziplinäre Kooperation junger Wissenschaftler anzuregen und zu vertiefen. Junge Wissenschaftler können WIN-Kollegiaten werden, wenn sie an Hochschulen und Forschungseinrichtungen des Landes tätig sind und sich durch innovative wissenschaftliche Leistungen ausgezeichnet haben. Das Programm ermöglicht diesen Forschern, an Projekten verschiedener Fachrichtungen mitzuarbeiten. Es setzt voraus, dass sie ihre gemeinsamen wissenschaftlichen Vorhaben selbständig organisieren. Mitglieder der Akademie stehen den Projektgruppen beratend zur Seite. So nimmt das WIN-Kolleg die Idee des fächerübergreifenden Gesprächs in der Akademie auf, bereichert zugleich deren wissenschaftliches Programm. Im WIN-Kolleg wurden bisher 13 Projekte zu verschiedenen Themen gefördert.
- Seit 2007 lädt die Akademie zu Konferenzen junger Wissenschaftler ein, in denen diese fächerübergreifenden Symposien und Arbeitstreffen ausrichten können. Die Nachwuchswissenschaftler bestimmen das Thema der Konferenz selbst, organisieren diese selbständig. Ein Akademiemitglied berät die Gruppe. Bisher wurden 13 Konferenzen gefördert. 2013 wurde diese Förderung auf internationale Akademiekonferenzen ausgeweitet. Gegenwärtig werden eine deutsch-tschechische und eine deutsch-baltische Konferenz unterstützt.
- Mit dem 2010 eingerichteten Akademie-Kolleg fördert die Heidelberger Akademie der Wissenschaften den Dialog zwischen jungen und erfahrenen Wissenschaftlern. Die Akademiemitglieder wählen junge Wissenschaftler in das Akademie-Kolleg. Dadurch gewinnen diese das Recht, an Sitzungen der Akademie teilzunehmen, können die Arbeit der Akademie insbesondere in ihren Nachhaltigkeitsprojekten beobachten, an den Diskussionen in der Akademie teilnehmen.
- Herausragende wissenschaftliche Mitarbeiter in den Forschungsstellen der Akademie werden durch Habilitationsstipendien unterstützt. Im letzten Jahr vor Abschluss ihrer Arbeit sind sie mit einer halben Stelle für ihre Habilitation frei gestellt.
- Die Heidelberger Akademie vergibt jährlich vier Preise für herausragende wissenschaftliche Leistungen an ausgewählte junge Wissenschaftler – den Akademie-Preis, den Karl-Freudenberg-Preis, den Walter-Witzenmann-Preis und Ökologiepreis der Sigrid-und-Viktor-Dulger-Stifung.
8. Ehrenamtlichkeit
Unser Berufs- und Wirtschaftssystem baut auf das Prinzip, dass Leistungen durch Gegenleistungen entgolten, durch Entgelt Anreize für immer bessere Leistungen geschaffen werden. Neben diesem auf Tausch angelegten Markt hat sich eine Welt selbstloser Leistungen entwickelt, in der ehrenamtlich Tätige allein um der Sache willen eine Aufgabe erfüllen. So entsteht eine wachsende Kultur der Gemeinnützigkeit. Die Mitglieder der Heidelberger Akademie sind ehrenamtlich tätig. Sie stellen ihre Arbeit unvergütet in den Dienst der Akademie. Dies gilt auch für ihre Mitarbeit in den Kommissionen der Akademie, für die Begleitung wissenschaftlicher Projekte, für die Begutachtung neuer Vorhaben. Diese Ehrenamtlichkeit prägt das Gesicht und die Tätigkeit der Akademie. Die Akademie erwirtschaftet keinen ökonomisch messbaren Ertrag. Die Projekte sind nicht auf Gewinnmaximierung angelegt. Die Mitglieder erzielen keine Gewinne. Wissenschaftliche Erfolge werden nicht individuell honoriert, sondern nützen allein der Allgemeinheit. Forschungsziel ist nicht der Ertrag, sondern die Erkenntnis. Die Akademie handelt ausschließlich gemeinnützig. Sie wird aus öffentlichen Mitteln und durch gemeinnützige Zuwendungen finanziert. Diese Ehrenamtlichkeit erspart der öffentlichen Hand, insbesondere dem Landeshaushalt, Aufwendungen, setzt einer stark erwerbsgeprägten Gesellschaft wissenschaftsbestimmte Gemeinnützigkeit entgegen, hält das Erwerbsmotiv von der mitgliedschaftlich organisierten Körperschaft der Akademie fern. Im Ehrenamt ist wissenschaftliche Freiheit angelegt. Diese Freiheit macht die Arbeit der Akademie unabhängig, unparteiisch und unbefangen. Forschungsvorhaben und Forschungsergebnisse hängen nicht von einer Nachfrage ab, die Leistungen erkennt und durch Honorar anerkennt. Die Forschung bleibt unabhängig, weil sie keiner politischen Richtung, keiner Interessengruppe und keinem Interessentenwissen verpflichtet ist, in ihrem wissenschaftlichen Auftrag nicht politischen Zielen folgt. Die Akademieforschung ist unbefangen, frei in Geist und Gehabe, zeigt in Inhalt, Form und Stil ihrer Arbeit, dass ihre Forschungen und Publikationen wissenschaftliche Ziele verfolgen. Die Akademie ist allein durch Prinzipien und Methoden der Wissenschaft geprägt. Darin sind ihre Forschungserfolge, ihre Anerkennung, die Nachhaltigkeit ihres Wirkens begründet. Die Akademiemitglieder üben ihr Amt als ein Amt der Ehre aus – nach bestem Wissen und Gewissen.
9. Öffentlichkeitswirkung
Wissenschaft ist auf Publikation angelegt. In der Werkstatt der Wissenschaft werden neue Erkenntnisse hervorgebracht, die auf Veröffentlichung drängen, der Allgemeinheit angeboten werden, um so die Lebensbedingungen und die Lebenskultur der Menschen zu verbessern. Im Werkbereich der Wissenschaft suchen Forscher nach neuen Erkenntnissen. In ihrem Wirkbereich begegnet die Wissenschaft einer Öffentlichkeit, sucht dort neue Erkenntnisse zu diskutieren, verständlich zu machen, ihre Nutzung zu empfehlen. Die Heidelberger Akademie der Wissenschaften ist eine von der demokratischen Öffentlichkeit getragene Körperschaft, die der Öffentlichkeit, den Bürgern und damit der Demokratie dient. In ihren ersten Jahrzehnten begegnete die Akademie der Öffentlichkeit vor allem in ihren Publikationen, Vortragsveranstaltungen und wissenschaftlichen Gesprächen. Heute nutzt die Akademie ein breites Spektrum der Medien, um neue Erkenntnisse, Sichtweisen und Verstehenshorizonte der Öffentlichkeit zu vermitteln.
- Die moderne Informationstechnologie verschiebt die Grenzen zwischen dem für Laien verständlichen Wissen und dem Fachwissen. Die Akademie vergewissert sich stets ihrer Wissenschaftssprache, prüft die Verständlichkeit ihrer Aussagen für die Allgemeinheit, organisiert Akademiekonferenzen zur Begegnung von Wissenschaft und Gesellschaft. Sie erschließt dem interessierten Bürger durch Vorträge, insbesondere durch eine von den wissenschaftlichen Mitarbeitern eigenverantwortlich gestaltete Vortragsreihe, neue Wissenschaftsgebiete, um in der Vielfalt der wissenschaftlichen Disziplinen Orientierung zu geben.
- Vorträge, Symposien, Podiumsdiskussionen, auch Live-Chats und Twitter-Sessions erschließen allgemeinverständlich Forschungsprojekte und Forschungsergebnisse. Die Themen reichen von „Energie und Umwelt“ über „Alte und Altern“ bis zur „Politikberatung in der Demokratie“, handeln damit von aktuellen Themen ebenso wie von entwicklungsbegleitender Nachhaltigkeit. Wissenschaftliche Vorträge nach den Plenarsitzungen und in der Vortragsreihe der Mitarbeiter informieren allgemeinverständlich über Forschungsprojekte, z.B. über die Sprache Goethes, über die Rolle der Kultur bei der Verbreitung des Menschen oder die Nano-Forschung. Sie berichten über ungewöhnliche Entdeckungen, offenbaren ihre wissenschaftlichen Ziele und Hoffnungen, geben der Akademie „Bürgernähe“.
- Der „Akademiesalon“ lädt zu gelehrten Gesprächen mit dem Publikum. Diese Kultur der Begegnung widmet sich derzeit dem Thema „Wunderkind“, erörtert das Phänomen jugendlicher Frühbegabungen in der Musik. Die Grundlagen dafür sind von der Forschungsstelle „Geschichte der südwestdeutschen Hofmusik im 18. Jahrhundert“ erarbeitet worden, die bisher verschollene Kompositionen wiederentdeckt, Noten für die Gegenwart umschreibt und für die Aufführung erschließt. Diese kleinen Weltneuaufführungen verdeutlichen das Anliegen der Akademie, die kulturellen Grundlagen unserer Gesellschaft für die Gegenwart bewusst und zugänglich zu machen.
- Bei der jährlichen „Akademievorlesung“ sprechen Gelehrte von Weltrang über ihre Forschungsarbeiten. Im vergangenen Jahr hat der Pulitzer-Preisträger Professor Stephen Greenblatt, Harvard University, über die Faszination der Renaissance und die Geburt der Moderne gesprochen.
- Die Akademie wendet sich mit ihrer Jahresfeier und ihrem Jahrbuch an die Öffentlichkeit und publiziert dort ihre wichtigsten Fragestellungen, Ergebnisse, Planungen. So erfüllt die Akademie den Auftrag, bei der Forschung öffentliche Begegnung und Kritik zu suchen, vor allem aber ihre Forschungsergebnisse zur Diskussion zu stellen, die Nutzung der Forschungserträge anzuregen und vorzu bereiten.
10. Zusammenfassung
Die Heidelberger Akademie der Wissenschaften vereint Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die in stetigem Austausch ihrer Fachdisziplinen unterschiedliche Wissenschaftskulturen zusammenführen und die Methoden wissenschaftlichen Arbeitens weiterentwickeln. Die Heidelberger Akademie pflegt den fächerübergreifenden Dialog, die nachhaltige Forschung und den Austausch zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit. Sie betreibt Forschungsprojekte zur kultur- und geisteswissenschaftlichen Grundlagenforschung, von der Erforschung der Anfänge der Menschheitsgeschichte über die Bewahrung und Erschließung des kulturellen Erbes mehrerer Jahrtausende bis zur kulturellen Neuorientierung der Gegenwart. In der Begegnung erfahrener und junger Wissenschaftler pflegt die Akademie besonders den Austausch zwischen Natur- und Geisteswissenschaften. Die Heidelberger Akademie der Wissenschaften ist eine Akademie des Landes, die wesentlich dazu beiträgt, dass der Wissenschaftsstandort im Südwesten Deutschlands mit seinen leistungsfähigen Universitäten und erfindungsreichen Unternehmen durch das Zusammenwirken von Medizin, Technik, Natur-, Geistes- und Kulturwissenschaften gestärkt, durch inhaltliche Anregungen der verschiedenen Fachdisziplinen ausgebaut und als Anziehungspunkt bedeutender Gelehrter aus aller Welt gesucht wird. Die Mitglieder der Akademie sind hochqualifizierte Spezialisten ihres Fachs. Im Bewusstsein, dass die Spezialisierung neue Erkenntnisse ermöglicht, aber auch erschwert, angemessene Antworten auf fächerübergreifende Fragen zu finden, suchen sie in der Akademie das interdisziplinäre sachorientierte Gespräch, aus dem neue Disziplinen entstehen oder traditionelle wissenschaftliche Sichtweisen erweitert und korrigiert werden, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in gemeinsamen Arbeitsgruppen und Fragestellungen zusammenfinden können. Die Politik will das gesellschaftliche Leben, den Umgang mit der Natur und die Entfaltung humaner Werte nachhaltig weiterentwickeln und erwartet dabei die Unterstützung durch die Wissenschaft. Die Akademie bietet den Raum für nachhaltig betriebene und wirksame Langzeitprojekte, die sich von den kurzen Rhythmen der Finanzplanung und der Qualifikationsarbeiten lösen, über die Person des einzelnen Forschers hinaus in kontinuierlichen Forschungsgruppen fortgesetzt werden. So entstehen Wissensspeicher, auf die künftige Generationen aufbauen können. Die Akademie wird zu einem Kompetenzzentrum, in dem ständig neue Fragen gestellt, nachhaltige Forschung angestoßen, für Kultur, Wirtschaft und Staat verlässliche Beurteilungs- und Handlungsperspektiven entwickelt und fortgeschrieben werden Die Heidelberger Akademie widmet sich in der Vielfalt ihrer Wissenschaften der Grundlagenforschung. Sie begreift das Entstehen und den Wandel von Kulturen in Sprache, erkennt in der Übereinkunft dank Sprache eine Grundlage für den Zusammenhalt von Kulturen und Demokratie, macht in sprachwissenschaftlichen und historischen Projekten bewusst, wie der Mensch denkt, seine Umwelt sieht, sich anderen mitteilt, tauscht und Vereinbarungen trifft, Handlungs-, Schutz- und Lebensgemeinschaften entwickelt. So gibt die Akademie gegenwärtigem Wissen und Denken Fundament und Verlässlichkeit, sichert eine nachhaltige Zukunft in ihrer Herkunft und in ihrer kulturellen Gegenwart. Dabei begegnen sich Kultur- und Geisteswissenschaften in der Frage, wie menschliches Handeln und kulturelle Eigenart gemessen, verstanden und gedeutet werden müssen. Die Akademie wählt ihre Wissenschaftler nach ihrer hervorragenden fachlichen Qualifikation, ihrer Erneuerungskraft, ihrer Offenheit für Selbstkritik und wissenschaftliche Zusammenarbeit aus. Die neuen Mitglieder werden nach Begutachtung in einem mehrstufigen Auswahlprozess geprüft und durch das Plenum der Mitglieder beider Klassen – der Philosophisch-historischen und Mathematisch-naturwissenschaftlichen – gewählt. Bisher wurden 31 Mitglieder der Heidelberger Akademie der Wissenschaften mit dem Nobel-Preis (27) und dem Balzan-Preis (4) ausgezeichnet. Davon sind heute noch neun aktiv, hinzukommen 41 Inhaber des Ordens Pour le Mérite, 30 Preisträger des Leibniz-Preiseses der Deutschen Forschungsgemeinschaft und 16 Preisträger des Landesforschungspreises Baden-Württemberg. Dieser hohe wissenschaftliche Anspruch an die Mitglieder bestimmt auch die Projekte der Akademie, die von den Mitgliedern vorgeschlagen und durchgeführt werden. Die Heidelberger Akademie der Wissenschaften hat mit Unterstützung des Landes Baden-Württemberg eine bundesweit einmalige Initiative entfaltet, die landesweit den besten Nachwuchswissenschaftlern eine Möglichkeit der Förderung bietet. Das wissenschaftliche Nachwuchskolleg (WIN-Kolleg) unterstützt die interdisziplinäre Kooperation junger Wissenschaftler. Akademiekonferenzen bieten jungen Wissenschaftlern Gelegenheit, fächerübergreifende Symposien und Arbeitstreffen auszurichten. In dem Akademie-Kolleg pflegt die Akademie den Dialog zwischen jungen und erfahrenen Wissenschaftlern. Herausragende wissenschaftliche Mitarbeiter in den Forschungsstellen erhalten Habilitationsstipendien. Jährlich werden vier Preise für herausragende wissenschaftliche Leistungen vergeben. Die Mitglieder der Heidelberger Akademie sind ehrenamtlich tätig. Sie stellen ihre Arbeit unvergütet in den Dienst der Akademie. In diesem Ehrenamt ist die Unabhängigkeit vom Erwerbsstreben und den Finanziers, ein gedanklicher Abstand zu unserer stark erwerbsgeprägten Gesellschaft angelegt. Das Ehrenamt bestärkt die wissenschaftliche Freiheit. Es entlastet die Haushalte des Landes und des Bundes. Wissenschaft ist auf Publikation angelegt, sucht die Öffentlichkeit, um neue Erkenntnisse zu diskutieren, sie öffentlich verständlich zu machen, ihre Nutzung zu empfehlen. Die Heidelberger Akademie der Wissenschaft pflegt diese Begegnung mit der Öffentlichkeit in den Formen der modernen Informationstechnologie, durch Vorträge, Symposien und Podiumsdiskussionen, durch einen Akademiesalon, eine Akademievorlesung und die jährlichen Jahresfeiern und Jahrbücher. Die Themen reichen von „Energie und Umwelt“ über „Alter und Altern“, „Wissenschaft und Gesellschaft“, die Sprache Goethes, die Rolle der Kultur bei der Verbreitung des Menschen, die Nano-Forschung, dem „Wunderkind“ bis zu der Sprache, in der Wissenschaften sich untereinander und mit der Öffentlichkeit verständigen können. So erfüllt die Akademie ihren Auftrag, eine von der demokratisch geformten Öffentlichkeit für diese Öffentlichkeit ein gerichtete Körperschaft der nachhaltigen Grundlagenforschung und des Austausches zwischen den wissenschaftlichen Disziplinen zu sein.
* In der Statusschrift wird für beide Geschlechter die männliche Form gebraucht