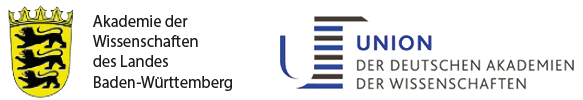Um die Buchvorstellungen auf den Verlagsseiten aufzurufen, klicken Sie bitte auf das jeweilige Buchcover.
Die Heidelberger Akademie der Wissenschaften im Spiegel ihrer Antrittsreden 2009–2023.
Mit einem Verzeichnis ihrer ordentlichen Mitglieder 2009–2023
Heidelberg, Universitätsverlag Winter, 2024

Mit ihrer Antrittsrede stellen sich die neu gewählten Mitglieder der Heidelberger Akademie der Wissenschaften vor. Darin geben sie Auskunft über ihre Herkunft und ihren Werdegang, ihre akademischen Lehrerinnen und Lehrer sowie ihre wissenschaftliche Arbeit. Die für alle gleiche Aufgabe der Selbstdarstellung wird auf ganz unterschiedliche Art und Weise gelöst. Unabhängig davon, ob der akademische Werdegang eher gradlinig oder mit Umwegen verlief, inwiefern Zufälle eine Rolle spielten oder persönliche Begegnungen sich als schicksalhaft erwiesen – alle Rednerinnen und Redner eint die Begeisterung für ihre Forschung.
Anlässlich ihres hundertjährigen Jubiläums veröffentlichte die Akademie im Jahr 2009 einen Sammelband, der alle bis zu diesem Zeitpunkt überlieferten Antrittsreden umfasste. Fünfzehn Jahre später versammelt nun dieser zweite Band die Antrittsreden aller Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die zwischen 2009 und 2023 zu ordentlichen Akademiemitgliedern gewählt wurden.
Die Herausgabe dieses Bandes wurde durch die finanzielle Unterstützung des Vereins zur Förderung der Heidelberger Akademie der Wissenschaften ermöglicht.
Goethe Wörterbuch, Achter Band, Sieb-sollen
Stuttgart, Verlag W. Kohlhammer, 2024

Herausgegeben von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen und der Heidelberger Akademie der Wissenschaften.
8. Band, 1. Lieferung
Ein republikanisches Experiment im 17. Jahrhundert. Commonwealth und Protektorat in England 1649–59/60
Ronald G. Asch
Heidelberger Akademische Bibliothek
Stuttgart, Alfred Kröner Verlag, 2024

Wenn heute in einer breiteren Öffentlichkeit über die Ursprünge des modernen Verfassungsstaates und der Demokratie diskutiert wird, fällt der Blick meist auf die Amerikanische und die Französische Revolution. Wenigen ist bewusst, dass die erste kodifizierte Verfassung in Europa 1653 in England verabschiedet wurde. Faktisch verdankt die moderne Demokratie dem Erbe des englischen Republikanismus ähnlich viel wie den Revolutionen des späten 18. Jahrhunderts. Es gibt allerdings einen wesentlichen Unterschied: Während uns das Gedankengut der Aufklärung durchaus noch vertraut ist, erscheint uns der radikale Protestantismus, der die Englische Revolution und die politische Neuordnung der 1650er Jahre prägte, sehr viel fremder, und das gilt auch für die Ideen des Mannes, der ihn wie kein anderer verkörperte: Oliver Cromwell. Es ist die Verbindung zwischen einem radikalen, durchaus modernen Bruch mit politischen Traditionen und einem Weltbild, das weithin christlich und biblisch geprägt blieb, die der Englischen Revolution ihren besonderen Charakter verleiht, und diese oft widersprüchliche Mischung unterschiedlicher Kräfte steht auch im Zentrum dieser knappen Darstellung. (Verlagstext)
Bürgerkriege und Epheben. Prinzipien und Praktiken bürgerlicher Sozialisation im antiken Griechenland
Hans-Joachim Gehrke
Heidelberger Akademische Bibliothek
Stuttgart, Alfred Kröner Verlag, 2024

Ein wesentliches Merkmal der antiken griechischen Geschichte war die Neigung zu gewaltsamen Auseinandersetzungen innerhalb der politischen Gemeinschaften, die sich nicht selten mit auswärtigen Kriegen verbanden. Gegen diesen »inwendigen Explosivstoff« (F. Nietzsche) haben sich diese Gemeinschaften auf vielfältige Weise zu sichern gesucht. Da viele der treibenden Faktoren im Ringen um Ehre, Rang und Überlegenheit ihren Ursprung in den Bürger-Kriegern der Gemeinschaften hatten, entwickelten diese Praktiken der Erziehung, die den ehrbewussten Nachwuchs in die Bürgergemeinde integrierten, ohne dessen kompetitiven Elan zu bremsen. Einsichten griechischer Intellektueller wie Platon, Xenophon und Aristoteles über den Zusammenhang von körperlicher Übung und psychisch-mentaler Einstellung spielten dabei eine große Rolle. So wird ein spezifisches Kennzeichen der griechischen Kultur, die Sozialisation junger Männer und Epheben im vielfältigen sportlich-mentalen Training im Gymnasion (›Nacktplatz‹), in diesem Buch auf neue Weise erklärt, als ein Mittel zur Vermeidung von Spaltung und zur Förderung von Gemeinsinn. (Verlagstext)
(Er-)Leben von Spiritualität. Die fünf Sinne in religiösen Gemeinschaften des Mittelalters
Julia Becker, Isabel Kimpel, Jonas Narchi, Bernd Schneidmüller (Hrsg.)
Klöster als Innovationslabore (externer Link), Band 14
Schnell & Steiner, 2024.

Sehen – Hören – Riechen – Schmecken – Tasten: Welche Bedeutung hatten die Sinneseindrücke mittelalterlichen Klöstern? Der interdisziplinäre Sammelband untersucht das Verhältnis der fünf Sinne und der Spiritualität in monastischen und regularkanonikalen Kontexten des Mittelalters.
Anselm von Havelberg, Epistola apologetica
Jonas Narchi (Hg.)
Klöster als Innovationslabore (externer Link), Band 13
Schnell & Steiner, 2024

Mit Sprachgewalt und innovativen Argumenten nimmt Anselm von Havelberg in seinem Verteidigungsbrief die weltzugewandten Regularkanoniker gegen Kritik vonseiten der Mönche in Schutz. Erstmals erscheint diese zentrale Quelle zu Geschichte und Spiritualität religiöser Gemeinschaften im Hochmittelalter nun in einer kritischen Edition mit deutscher Übersetzung und Sachkommentar.
Lords of the Mountains. Pre-Islamic Heritage along the Upper Indus in Pakistan
Harald Hauptmann, Luca Maria Olivieri (Hg.)
Heidelberg University Publishing, 2024

Mit seiner maßgeblichen Monographie Lords of the Mountains. Pre-Islamic Heritage along the Upper Indus in Pakistan hat Harald Hauptmann seine jahrzehntelangen Forschungen in der Karakorum-Region Nordpakistans zu einem beeindruckenden Abschluss gebracht. Dieses Buch, das vor seinem plötzlichen Tod im Jahr 2018 fertiggestellt wurde, ist gewissermaßen das wissenschaftliche Vermächtnis der letzten Phase seiner Karriere. Herausgegeben wurde das Buch von Luca M. Olivieri von der Universität Ca' Foscari in Venedig, dem Leiter der ISMEO und der italienischen archäologischen Mission von Ca Foscari in Pakistan. (Nach dem Vorwort von H. Parzinger)
Der lyrische Nachlass des jungen Nietzsche. Mit einer Edition des Manuskripthefts Mp I 22
Armin T. Müller
Nietzsche-Lektüren (externer Link), Band 11
De Gruyter, 2024

Armin Thomas Müllers Arbeit nimmt den bislang in der literaturwissenschaftlichen wie auch philosophischen Auseinandersetzung mit Friedrich Nietzsche vernachlässigten lyrischen Nachlass aus der Zeit zwischen 1850 und 1869 in den Blick. Anschließend an eine grundlegende Einführung in das Thema wird Nietzsches Jugendlyrik überblicksartig vorgestellt mit Schwerpunkten zur Editions- und Forschungsgeschichte, zu literaturgeschichtlichen Kontexten sowie zu den autoreflexiven Aufzeichnungen des jungen Nietzsche, die das Thema (lyrischer) Dichtung umkreisen.
Die vorliegende Publikation enthält zudem eines heutigen materialorientierten Standards entsprechende Faksimile-Edition mit diplomatischer Transkription des Manuskripthefts Mp I 22 von 1858. Das kulturgeschichtliche Erkenntnispotenzial in Nietzsches Jugendgedichten wird abschließend in einer textgenetischen und historisch kontextualisierenden Analyse der edierten lyrischen Texte aus Mp I 22 deutlich. (Verlagstext, gekürzt)
Diphilos. Paralymenos-Chrysochoos
Ioanna Karamanou
Fragmenta Comica, Band 25.2
Verlag Antike, 2024

This volume forms the second part of the three-volume commentary on the fragments of Diphilus, who belongs to the prominent triad of the poets of New Comedy alongside Menander and Philemon. The present volume comprises the text and an English translation of the fragments of twenty-two plays of Diphilus, followed by a full-scale (philological, thematic, literary, interpretative, historical) commentary that also yields insight into the reception of Diphilan comedy in Roman theatre. This in-depth study of the Diphilan techniques of verbal humour and performance aims at shedding light on the dramatist's distinctive place in the comic tradition, as well as showcasing a degree of variation in the overall image of the production of new comedy. (Verlagstext)
Laughing at domestica facta. Identity construction in mid-Republican Rome through the lens of the togata
Giuseppe E. Rallo
Studia Comica, Band 21
Vandenhoek & Ruprecht Verlage, 2024

In this monograph, the author embarks on a captivating journey to shed fresh light on the togata, a mid-Republican theatrical genre which survives only in fragments. The book seeks to answer pressing questions surrounding the togata's significance in identity construction during the middle Republic from a literary and cultural perspective. Delving deep into the fragmentary textual remains of the togata, the book explores how the Roman elite fashioned their identity. The author challenges the notion of monolithic identity construction, and explores the diverse forms of identity within the togata, offering a new perspective on the subject. This study thus positions the togata as a vital source for discerning the characteristics and beliefs by which the Romans distinguished themselves and their culture from others. By examining how Romans perceived themselves, their ideas about different social groups, and their literary and cultural ties to earlier traditions, this book aims to transform our understanding of the togata's role in Roman drama. (Verlagstext)
Keilschrifttexte aus Assur literarischen Inhalts 17. Texte verschiedenen Inhalts. Mit Beiträgen von Hanspeter Schaudig
Aino Hätinen
Wissenschaftliche Veröffentlichungen der Deutschen Orient-Gesellschaft (externer Link), Band 164 (externer Link)
Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2024
In diesem Band werden 74 Tontafeln und Tontafelfragmente aus der mittel- und neuassyrischen Zeit, die mehreren unterschiedlichen Genres literarischer Texte zuzuordnen sind, ediert. Keine der einzelnen Textgruppen wäre groß genug gewesen, um damit einen eigenen Band zu füllen. Neben Götterlisten und Nachschlagewerken, die den Menschen im Altertum Auskunft darüber erteilten, was an einem bestimmten Monatstag zu tun oder besser zu unterlassen sei, wird eine Reihe von Tontafelbruchstücken vorgelegt, deren am besten erhaltener Abschnitt der an den Schluss gestellte Kolophon darstellt. Diese Tafelbeischriften bieten unschätzbare Einblicke in die altorientalische Schriftgelehrsamkeit, indem sie Namen und Stellung der Schreiber, die Daten der Niederschrift und den Zweck benennen, zu dem ein niedergeschriebener Text einst bestimmt war. Hinzu kommen Editionen einiger astronomisch-astrologischer Texte sowie eine Reihe weiterer Tontafeln, die sich den großen, in den KAL-Bänden gebildeten Textcorpora nicht zuordnen ließen oder aber erst nach der Fertigstellung eines Bandes identifiziert wurden. Zu den bemerkenswertesten Texten aus dieser Gruppe zählen die detaillierte Beschreibung des Verfahrens zur Bestimmung eines assyrischen Eponymen und ein bislang unbekanntes Tafelfragment mit Resten eines Textes, der große Ähnlichkeit zu den sogenannten mittelassyrischen Gesetzen aufweist.
Ausführliche Konkordanzen und Indices, darunter ein Glossar der akkadischen Wörter und ein Verzeichnis der Götter-, Personen- und Ortsnamen, sowie Abbildungen der Keilschrifttexte in Form von Handzeichnungen und Fotografien runden den Band ab. (Verlagstext)
Keilschrifttexte aus Assur literarischen Inhalts 16. Historisch-epische Texte
Stefan Jakob
Wissenschaftliche Veröffentlichungen der Deutschen Orient-Gesellschaft (externer Link), Band 163
Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2024

Dieser Band ist den in Assur entdeckten historisch-epischen Keilschrifttexten gewidmet. Editionen der insgesamt 53 Tontafeln und Tontafelfragmente erschließen ganz neue Einblicke in die höfische Literatur Assyriens des späten zweiten und frühen ersten Jahrtausends v. Chr. Die epischen Erzählungen künden von den militärischen Großtaten assyrischer Könige. Dabei stellen sich die anonym bleibenden Autoren stets in den Dienst der Herrscherideologie. Siege über das von den Kassiten regierte Babylonien werden zum Triumph der göttlichen Gerechtigkeit, und einen Feldzug gegen nordöstlich von Assyrien gelegene Bergländer besingt der Dichter in einem Heldenlied, in dem ein Beschluss der göttlichen Ratsversammlung dem assyrischen König zum Sieg verhilft. Gleich mehrere zuvor unbekannte Tafelbruchstücke erweitern unsere Kenntnis des nur fragmentarisch überlieferten Epos, welches den Sieg des mittelassyrischen Königs Tukultī-Ninurta I. (1233–1197 v. Chr.) über Babylonien beschreibt. Andere neuentdeckte historisch-epische Texte aus Assur sind jedoch so stark beschädigt, dass es derzeit nicht gelingt, den jeweils besungenen königlichen Helden namentlich zu benennen. Bisweilen ist es nicht einmal möglich, einen klaren Erzählstrang zu erkennen.
Ausführliche Konkordanzen und Indices, darunter ein Glossar der akkadischen Wörter und ein Verzeichnis der Götter-, Personen- und Ortsnamen sowie Abbildungen der Keilschrifttexte in Form von Handzeichnungen und Fotografien runden den Band ab. (Verlagstext)
Plautus Revisited. Problemstellungen und Perspektiven der Plautusforschung
Gregor Vogt-Spira und Bernhard Zimmermann (Hg.)
Studia Comica, Band 20 (externer Link)
Vandenhoek & Ruprecht Verlage, 2024
Der Band bietet die Ergebnisse zweier internationaler Symposien, die das von der Union der Akademien geförderte Forschungsvorhaben „Kommentierung der Fragmente der griechischen Komödie“ (KomFrag), das derzeit das Bild über die griechische Komödie verändert und erweitert, und die Plautus-Forschung zusammengeführt haben. Vorgelegt wird nicht ein weiteres Kompendium zu Plautus; im Mittelpunkt stehen vielmehr die Perspektiven künftiger Forschung: Wo liegen Ansätze, die Antworten auf ungelöste Fragen versprechen? Wo sind neue Fragestellungen und Herangehensweisen zu erkennen, die bislang vernachlässigte Horizonte eröffnen? Oder auch, wo sind Materialien neu erschlossen, die ein anderes Licht auf die plautinische Komödie werfen können? Am Ende eines jeden Beitrags werden Horizonte und Aufgaben der Forschung formuliert. Ziel des Bandes ist es, sowohl den Plautus-Studien wie dem wechselseitigen Austausch zwischen griechischer und römischer Komödienforschung neue Impulse zu geben. (Verlagstext)
Menander. Einleitung
Niklas Holzberg
Fragmenta Comica, Band 24.1
Verlag Antike, 2024

Das Buch ist eine Einführung in Leben und Werk des griechischen Komödiendichters Menander (342/41-291/90 v. Chr.), des ältesten uns bekannten Dramatikers, der Stücke schrieb, in denen (wie heute z. B. noch in Hollywood-Produktionen) ein Liebespaar nach Irrungen und Wirrungen Hochzeit feiert. Es verbindet Angaben zur Vita mit der Geschichte der Überlieferung und der Rezeption in der Antike. Dabei geht es auf die Entwicklung der antiken Komödie ebenso ein, wie auf den moralphilosophischen Gehalt der Stücke und das Verhältnis Menanders zum Stadtstaat Athen. Es enthält zudem Interpretationen der Komödien, die als ganze zu überblicken sind, darunter der Dyskolos („Der Schwierige“), das einzige vollständig überlieferte Stück. Komödien, die in größeren Bruchstücken erhalten sind, sowie die römischen Bearbeitungen des Plautus und Terenz werden ebenfalls interpretiert. Die griechischen Zitate sind übersetzt. (Verlagstext)
Kommentar zu Nietzsches Also Sprach Zarathustra I und II
Katharina Grätz
Nietzsche Kommentar (externer Link), Band 4/1
Berlin/Boston, De Gruyter, 2024

Der Band 4.2 enthält den Kommentar zum dritten und vierten Teil von Nietzsches Also sprach Zarathustra. Entstanden in den Jahren 1883 bis 1885 handelt es sich um das populärste Werk Nietzsches, das aufgrund seiner poetischen Form und seiner Rätselhaftigkeit enorme Strahlkraft entfaltet hat, aber auch, weil es mit dem "Übermenschen" und der "ewigen Wiederkunft" zentrale Konzepte Nietzsches vorstellt. (Verlagstext)
Homicide Law in 19th-Century Nepal - A Study of the Mulukī Ains and Legal Documents
Rajan Khatiwoda
Documenta Nepalica: Book Series (externer Link), Band 7
Heidelberg, Heidelberg University Publishing, 2024

Hauptziel dieses Buches ist eine detaillierte Analyse der Entstehung und Durchsetzung des nepalesischen Mulukī Ain von 1854, wobei das Hauptaugenmerk auf den Bestimmungen zum Mord innerhalb der Mulukī Ains von 1854 und 1870 liegt. Daneben untersucht die Studie auch zeitgenössische juristische Aufzeichnungen, die die Komplexität der Umsetzung des Ain aufzeigen. Die Paragraphen zu Tötungsdelikten dienen als Mikrokosmos, anhand derer sich die allgemeine Entwicklung des nepalesischen Rechtssystems veranschaulichen lässt. Dieses löste sich von veralteten Strafen wie der Genitalverstümmelung und führte stattdessen Geld- und Freiheitsstrafen ein. Dennoch sind die Neuerungen, die in das Ain von 1854 aufgenommen wurden, nicht durchweg fortschrittlich. Somit zeigt das Ain in seinen verschiedenen Entwicklungsstadien die komplexen Veränderungen, die Rechtssysteme unweigerlich durchlaufen. (Verlagstext)